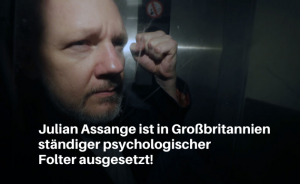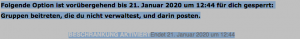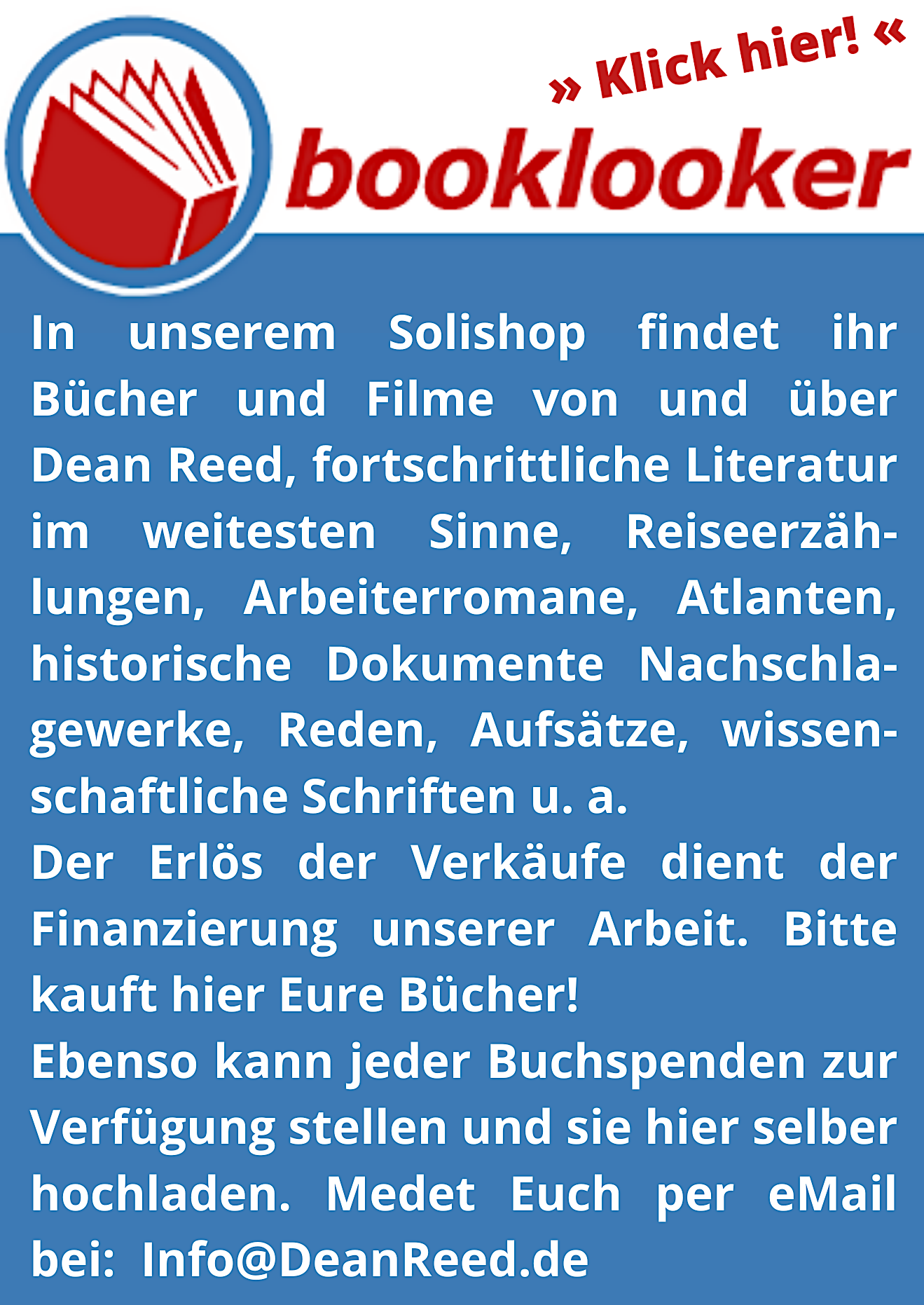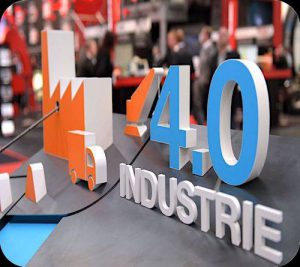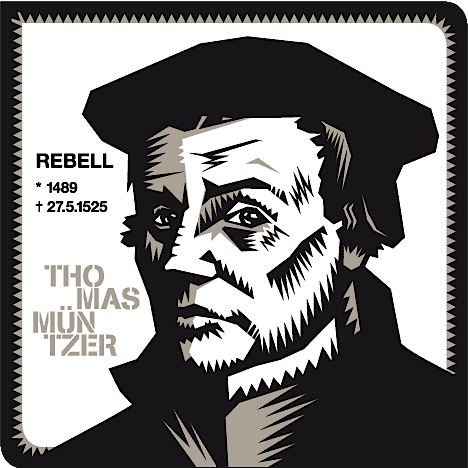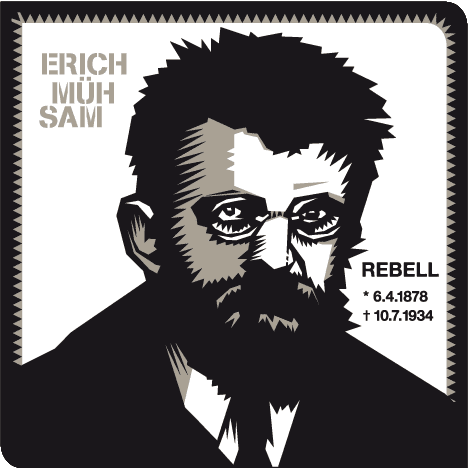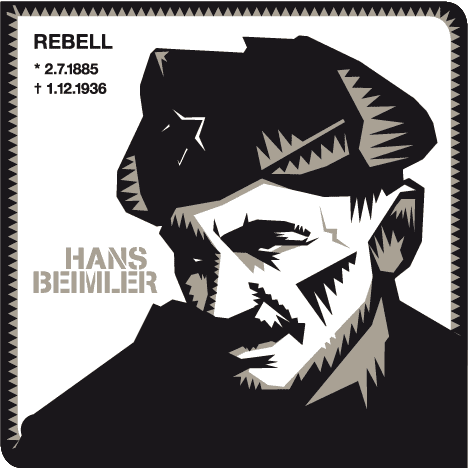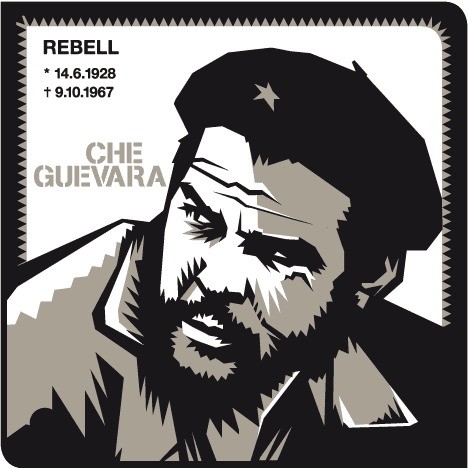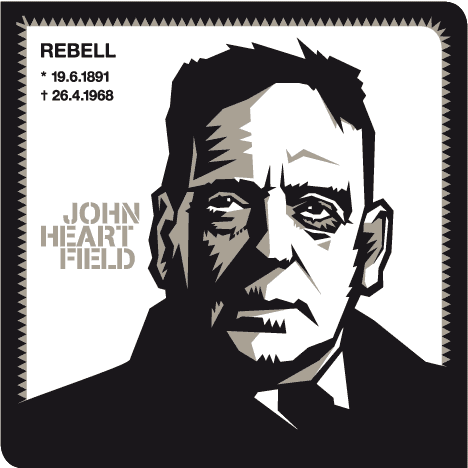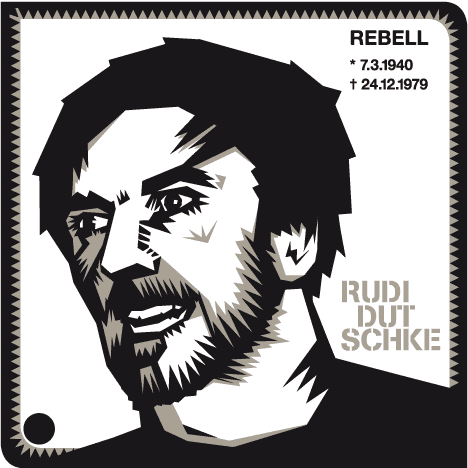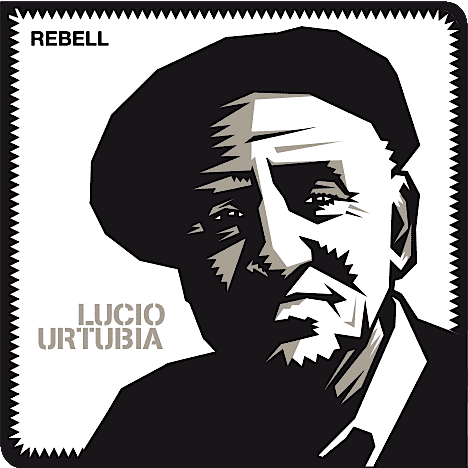Frank Burkhard
Dürfen darf man alles – ?
Die Kurt Tucholsky-Gesellschaft tagte in Leipzig zum Thema Satire

Frank Burkhard
Kurz vor Weihnachten 1919 fragte sich Theobald Tiger alias Kurt Tucholsky: „Was schenke ich dem kleinen Michel zu diesem kalten Weihnachtsfest?“ Und nachdem er den Nachttopf auf Rollen und das Puppenkrematorium verwarf, kam er darauf: „Ein neues gescheites Reichsgericht – das hat er noch nicht. Das hat er noch nicht!“

Kurt Tucholsky Gesellschaft, Plakat zur Tagung
Das frühere Reichsgericht in Leipzig, das jahrzehntelang als Dimitroff-Museum diente und inzwischen das Bundesverwaltungsgericht beherbergt, war einer der Schauplätze der Jahrestagung der Kurt Tucholsky-Gesellschaft, die unter dem Motto „Dürfen darf man alles“ Möglichkeiten und Grenzen der Satire behandelte. In Leipzig hatte 1931 auch der berüchtigte Weltbühne-Prozess stattgefunden, bei dem der Journalist Walter Kreiser und der Herausgeber Carl von Ossietzky wegen angeblichen Verrats von Militärgeheimnissen zu je 18 Monaten Haft verurteilt wurden. Von diesem spektakulären Strafverfahren, das bis heute als Musterbeispiel politischer Justiz in der Weimarer Republik gilt, war bei der anekdotengespickten Führung durch das Haus allerdings nicht die Rede, und schon gar nicht von dem Ponton-Prozess zum Veltheimer Fährunglück, der die Pressefreiheit 1928 mit Füßen trat. Bernd Brüntrup, Mindener Rechtsanwalt, hielt dazu einen bemerkenswerten Vortrag.
Vor 30 Jahren war die Kurt Tucholsky Gesellschaft von Anhängern des Autors aus BRD, DDR, der Schweiz und Großbritannien in Weiler im Allgäu gegründet worden. Der heutige Vorsitzende der literarischen Vereinigung, Dr. Ian King aus London, war am Anfang dabei und leitete nun die Jubiläumstagung, die in Zusammenarbeit mit der Universität Leipzig über die Bühne ging. Sie hatte zuweilen etwas von jugendlichem Elan. Dazu trugen die Vorträge von Studentinnen und Studenten bei, die satirische Wirkungslinien von Tucholsky bis in die Gegenwart aufzeigten. So hatte die Hip-Hop-Gruppe Advanced Chemistry Tucholskys medienkritisches Gedicht „An das Publikum“ adaptiert, und den Text vorsichtig verändert. Oder Rainald Grebe, der mit seinem Song „Oben“ („Oben, Ich bin oben. Ist das schön. Von oben, Runter zu sehen.“) zumindest thematisch an Tiger-Tucholskys Couplet „Raffke“ von 1922 anknüpft: „Und macht ihrs doll – ick mache immer Dollar! Ick knie mir rin, ick knie mir richtig rin!“
Bilder, Videos und Bildunterschriften wurden von der Redaktion AmericanRebel hinzugefügt.
.
Weitere Artikel von Frank Burkhard
Für den Inhalt dieses Artikels ist der Autor bzw. die Autorin verantwortlich.
Dabei muss es sich nicht grundsätzlich um die Meinung der Redaktion handeln.
Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung –
Nicht kommerziell – Keine Bearbeitungen 4.0 International Lizenz.Auch linker Journalismus ist nicht kostenlos
und auch kleine Spenden können helfen Großes zu veröffentlichen!