Bastian Reichardt
Autoritär und ohne dialektischen Anspruch

Bastian Reichardt
#aufstehen Die lange angekündigte linke Sammlungsbewegung um Sahra Wagenknecht formiert sich. Die Fronten verhärten sich und Skepsis scheint angebracht. Eine Streitschrift
Die »Bewegung«, die seit wenigen Tagen unter dem Titel #aufstehen in den sozialen Medien und in den Zeitungen diskutiert wird, ist im Vergleich zu anderen Bewegungen untypisch. Sie wurde am Reißbrett von einer Handvoll politischer Akteure entworfen, medial gestaltet und nun in die Öffentlichkeit gebracht. In diesem Sinne ist #aufstehen autoritär. Die »Bewegung« vollzieht sich von oben nach unten – von den Funktionärsbüros auf die Straße. Ob der Schritt vom Engagement der Parlamentarier auf die Straße nachhaltig klappt, muss sich zeigen. Eine gewisse Skepsis ist jedoch angebracht. Denn: Jede autoritäre Politik spielt insofern mit dem Feuer als sie sich als Stimme einer »schweigenden Mehrheit« inszeniert. Das lässt sich bei #aufstehen sehr deutlich beobachten. Die Mär geht ungefähr so: »Es gibt eine Mehrheit in Deutschland, die eine linke Politik befürwortet. Leider ließ sich dies in der Vergangenheit nicht politisch umsetzen. Also brauchen wir ein Forum, das dieser Mehrheit nun eine Stimme gibt.« Richtig ist dahingegen, dass es eine Mehrheit für das konservative und rechte Lager gibt. Nichts anderes zeigt ja die Zusammensetzung des Bundestages, der doch immerhin von der deutschen Bevölkerung gewählt wurde. Wer sich darauf beschränkt, dass eine Mehrheit der Menschen für soziale Gerechtigkeit ist, klammert naiverweise aus, welche Rolle es dabei spielt, wie verschiedenen Angebote der Parteien der Bevölkerung schmackhaft gemacht werden, um den Begriff »soziale Gerechtigkeit« zu füllen. Dies ist die Falle im Denken, man würde für eine »schweigende Mehrheit« sprechen: Wer es nicht schafft, sein Angebot in einem Wahlkampf zu verkaufen, gibt sich nur allzu leicht der Illusion hin, die Bevölkerung stünde dennoch – trotz der nackten Zahlen – auf seiner Seite.
Die »von oben nach unten«-Strategie verfehlt dazu noch einen grundsätzlichen strategischen Punkt marxistischen Gedankenguts – und zwar dass die Parteien und Politiker der allerletzte Kulminationspunkt von Bewegungen sind (und nicht wie hier der Ausgangspunkt). Wie der italienische Marxist Antonio Gramsci dargelegt hat, nimmt die Hegemonie einer Idee ihren Ausgang immer erst in der Zivilgesellschaft, entwickelt sich dort und wird nach langen, schwierigen Prozessen in der Politik übernommen. Sollte die Politik mit einer Situation konfrontiert sein, in der ihre Ideen keine zivilgesellschaftliche Vorherrschaft besitzen, dann bleibt ihr nur der Zwang. Linke Parteien müssen also versuchen, sich auf die Spitze von gesellschaftlichen Bewegungen zu setzen. Sie selbst zu initiieren, geht in die falsche Richtung.

Sahra Wagenknecht, Foto: jusch, Pixabay, CC0 Creative Commons
Was die ersten Inhalte von #aufstehen angeht, muss man leider sagen, dass die ersten Unterstützer sich bereits jetzt Gedanken darüber machen sollten, ob es nun schon wieder Zeit ist, abzuspringen. Zwar zeigen die Videos der Website völlig berechtigte Forderungen, von denen Linke sich wünschen würden, sie seien umgesetzt. Jedoch reden die Initiatoren dieser »Bewegung« eine andere Sprache. Insbesondere Lafontaine, Streeck und Stegemann kreisen in ihren Zeitungsartikeln so gut wie ausschließlich um das Thema Migration. Bedient wird immer wieder eine Argumentation, die Linke tunlichst meiden sollten und die aufbaut auf dem Satz »Wir können doch nicht alle aufnehmen«. Dazu setzt die »Bewegung« auf die Frage, wie moralisch hochnäsig Linke eigentlich sind, wenn sie offene Grenzen fordern. Vom letzten Punkt ist auch Wagenknecht nicht ausgenommen, wie ihr Artikel in der Welt vor Kurzem zeigte, in dem ein moralisierender Stil der »No Border, No Nation«-Vertreter angeklagt wurde. Tatsache ist jedoch: Wer andere belehrt, sie sollten im politischen Diskurs nicht moralisieren, der moralisiert eben auch selbst. Die Anklage der Hypermoral ist selbst schon eine moralische Anklage und keine politische.
hier geht es weiter »
Als Hauptankläger der Hypermoral stilisiert sich Bernd Stegemann, der Vorsitzende des #aufstehen-Vereins. So verteidigt der Dramaturg Stegemann den Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer in einem Beitrag, der im Mai in der Zeit erschien als »tragischen Held unserer Tage«. Der (zumindest dem Parteibuch zufolge) Grüne hatte in den sozialen Medien wieder einmal für Erregung gesorgt als er von der dunklen Hautfarbe eines pöbelnden Radfahrers unmittelbar darauf schloss, dass es sich um einen Asylbewerber handeln muss. Zitat Palmer auf seiner Facebook-Seite: »… weil ich wette, dass es ein Asylbewerber war. So benimmt sich niemand, der hier aufgewachsen ist mit schwarzer Hautfarbe.« Ja, der tragische Held unserer Tage. Der Vorsitzende von »Aufstehen Trägerverein Sammlungsbewegung e.V.«, Bernd Stegemann, nimmt Palmer gegen jene in Schutz, die sich über solche Aussagen empören und wirft ihnen letztlich nichts anderes vor als eine falsch verstandene Moral, die im Politbetrieb angemessen sein soll. Wie aber einflussreiche Politikwissenschaftler und Philosophen – wie etwa der amerikanische Harvard-Professor Michael Sandel – längst gezeigt haben, gibt es keine klare Trennung zwischen Politik und Moral. Wenn die Politik entscheidet, in welcher Gesellschaft wir leben sollen, dann ist sie immer schon in moralischem Terrain unterwegs. Die Frage der sozialen Gerechtigkeit ist eine moralische Frage.
Sollte es der »Bewegung« tatsächlich gelingen in den nächsten ein oder zwei Jahren stark genug zu werden, um merklichen Druck auf die Parteien auszuüben, dann muss jedem Mitglied der Linkspartei klar sein, dass dies auch Druck auf DIE LINKE bedeutet. Innerparteiliche Kritiker einer solchen »Bewegung« müssen befürchten, dass die Partei dadurch zu einer restriktiveren Migrationspolitik geführt wird. So würde DIE LINKE zu einer Partei werden, die ein Einwanderungsgesetz formuliert und demnach auch Abschiebungen befürwortet. Ein klarer Bruch mit dem Selbstverständnis der Partei.
Hinzu kommt, dass die inhaltliche Ausrichtung auch in anderen Aspekten erheblich von der Linie der Linkspartei abweicht. Wagenknecht hat dies ausgedrückt als sie in einem Gastbeitrag für die Nordwest-Zeitung schrieb, inhaltlich gehe es um die „klassische sozialdemokratische Tradition“. Zu denken, dass die SPD momentan etwas anderes macht als sozialdemokratische Politik, ist allerdings abstrus. Die SPD ist nicht von irgendeinem linken Kurs abgekommen, auf den man sie wieder zurückbringen müsste. Der Trick ist: Das, was wir täglich erleben, ist sozialdemokratische Politik. Ein Erfolgsmodell seit 1914. Die SPD versucht nicht einmal die Systemfrage zu stellen, sondern ist ihrem Selbstverständnis nach bemüht, den Kapitalismus so einzudämmen, dass die Verlierer dieses Systems nicht allzu viel verlieren. Dass die Partei selbst dieses bescheidene Ziel längst aufgegeben hat, liegt auf der Hand und begründet sich durch die Logik der Sozialdemokratie. Diese sucht seit Ende der 1990er nach dem »Dritten Weg« zwischen Neoliberalismus und Sozialismus, den Anthony Giddens vorgeschlagen hat und der sich programmatisch im Schröder/Blair-Papier wiederfindet. Der britische Politologe Giddens urteilte damals, dass die Sozialdemokratie sich durch Reformen erneuern müsse, um nicht unterzugehen. Der Treppenwitz der Sozialdemokratie ist allerdings: Der »Dritte Weg« führte geradewegs in den ersten Weg des Neoliberalismus. Und dies bedeutete ihren Untergang. Für die »Bewegung« #aufstehen heißt dies, dass sie sich inhaltlich irgendwo zwischen der jetzigen SPD und LINKE positionieren wird. Für Vertreter der politischen und gesellschaftlichen Linken – also jener Leute, die sich auf Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht berufen – muss dies unzumutbar sein. Denn für Luxemburg und Liebknecht war die SPD schon zu rechts als sie noch links war.
Wo die »Bewegung« hingeht, sieht man auch an ihrem neuen Aushängeschild Peter Brandt – dem Politikwissenschaftler der FernUni Hagen und Sohn des ersten SPD-Kanzlers. Der von Oskar Lafontaine auf Facebook gefeierte Neuzugang Peter Brandt publiziert seit Anfang der 1980er vor allem über Fragen des deutschen Nationalbewusstseins. Spätestens seit einem Interview, das er der Jungen Freiheit im Oktober 2010 gab, sollte klar sein, dass er einem national-konservativen Spektrum der Sozialdemokratie angehört. Die Rede vom »Tätervolk« sei destruktiv, wenn man endlich die »deutsche Neurose« überwinden wolle, wie es in diesem Interview mit der ultra-rechten Wochenzeitung heißt.
Dass der Versuch, ein rot-rot-grünes Lager zu einen, absurd ist, sollte eigentlich gerade den Sympathisanten von Wagenknecht klar sein – also denjenigen, die dem Institut Solidarische Moderne skeptisch gegenüberstehen. Mit diesem think tank forciert Katja Kipping seit Jahren eine Annäherung dieser drei Parteien. LINKE, SPD und Grüne sind jedoch grundverschieden, weil sie von verschiedenen Ideologien geleitet werden: neoliberal versus kollektivistisch. Für die einen steht das selbstverantwortliche Individuum im Vordergrund, für die anderen die solidarische Gemeinschaft. Dazwischen gibt es kein Drittes.
Zuletzt arbeitet sich die »Bewegung« nicht an den inneren Widersprüchen der herrschenden Politik ab, sondern übernimmt deren Grundgedanken, dass Sozialstaat und Nationalstaat Hand in Hand gehen müssen und dass wir deswegen zu einer restriktiv-regulierten Einwanderung kommen müssen. Dieser Grundgedanke der herrschenden Politik wird dann unkritisch mit linken Themen ausgeschmückt und überformt, aber nicht in sein Gegenteil verkehrt. Der ganze Ansatz ist also nicht dialektisch im Denken, sondern ergibt sich dem herrschenden Diskurs, ohne seine Widersprüche aufzudecken. Dies ist allerdings nur wenig verwunderlich. Denn gerade in dieser Frage merkt man sehr deutlich, welchen Einfluss der ehemalige SPD-Vorsitzende in der »Bewegung« hat. Jener SPD-Vorsitzende, der in den 1990er Jahren zusammen mit der Union das bis dahin liberalste Asylgesetz vor die Schlachtbank geführt hat. Seit diesem Asylkompromiss zwischen Union und SPD kämpft DIE LINKE für eine Wiederherstellung des Asylgesetzes. Die neue »Bewegung« steuert allerdings das Gegenteil an.
.
Für den Inhalt dieses Artikels ist der Autor bzw. die Autorin verantwortlich.
Dabei muss es sich nicht grundsätzlich um die Meinung der Redaktion handeln.
.
 .
.
|
|
Auch linker Journalismus ist nicht kostenlos
und auch kleine Spenden können helfen Großes zu veröffentlichen! |







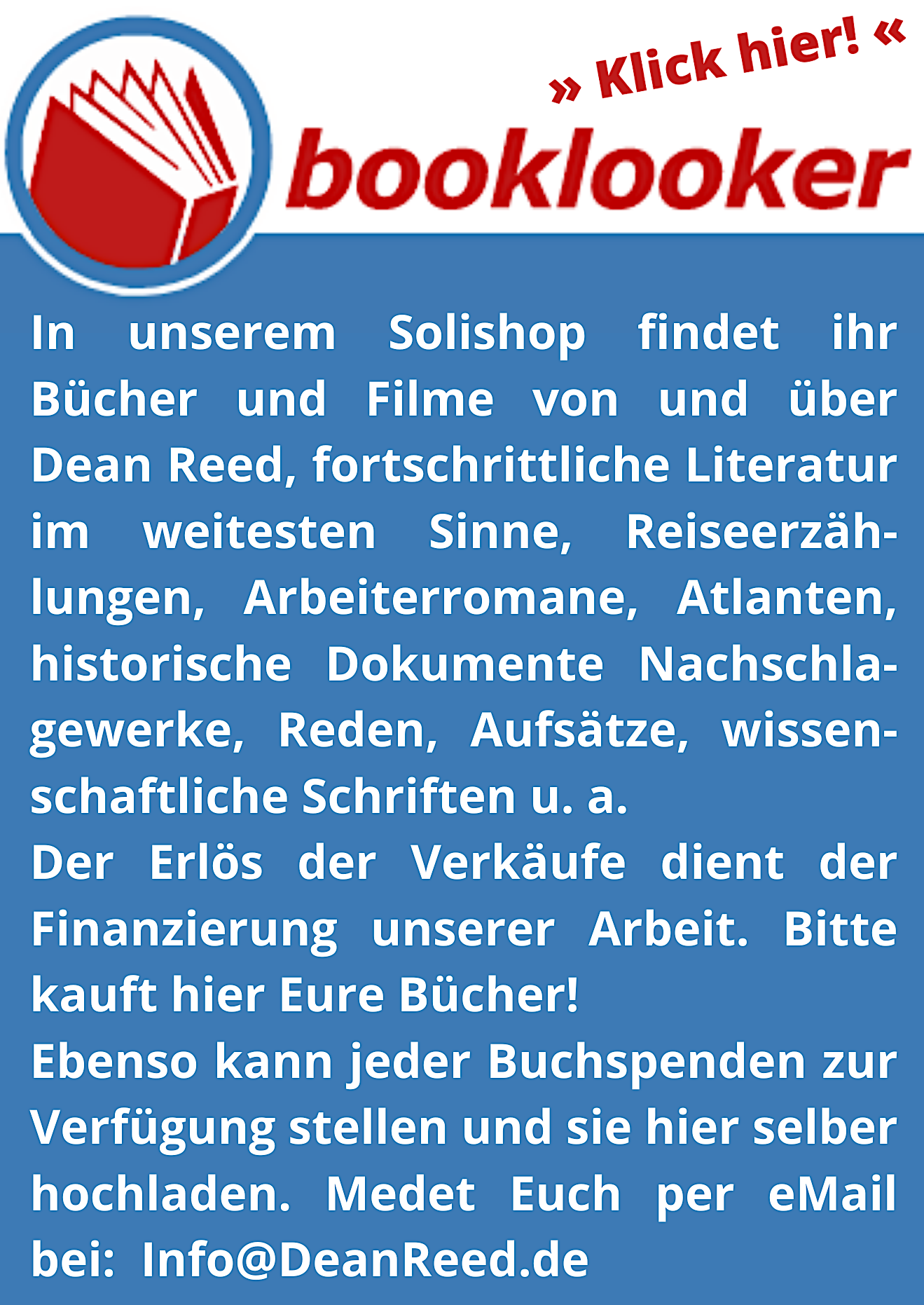














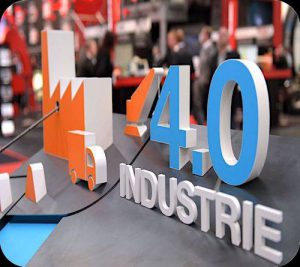













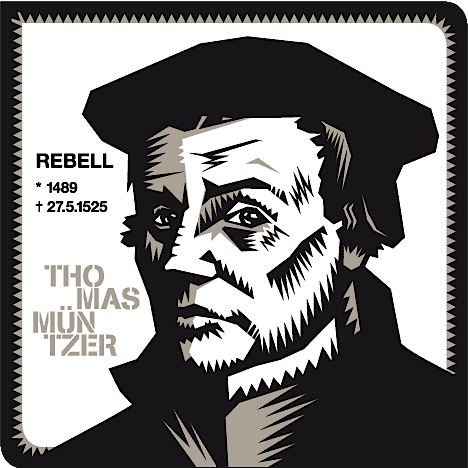


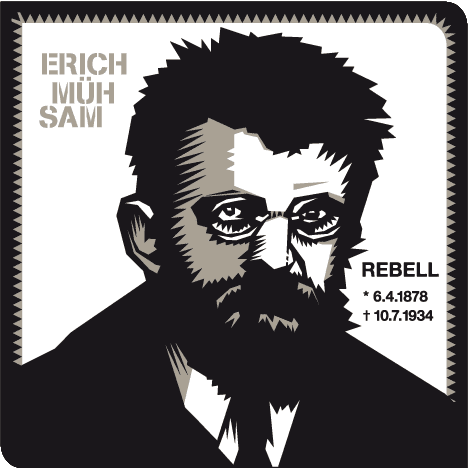
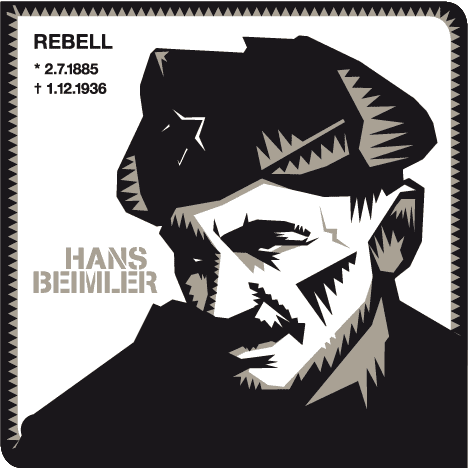


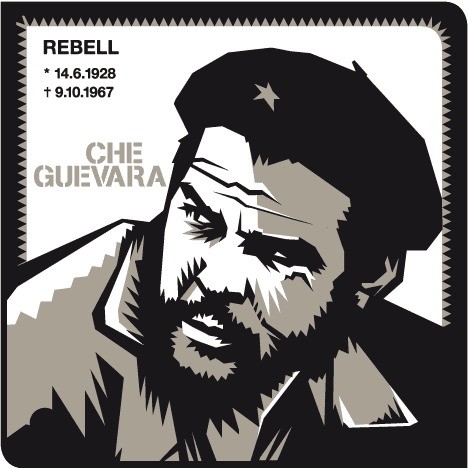
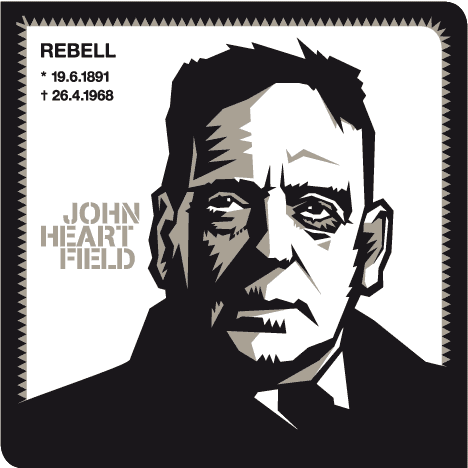

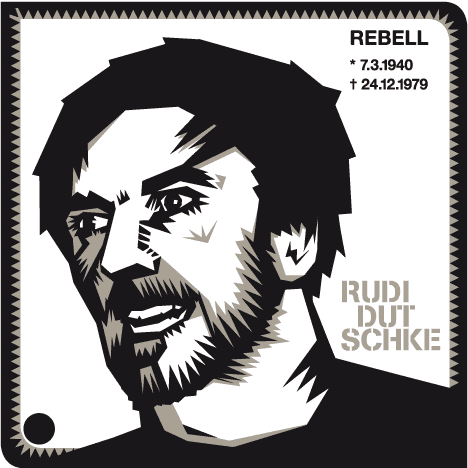
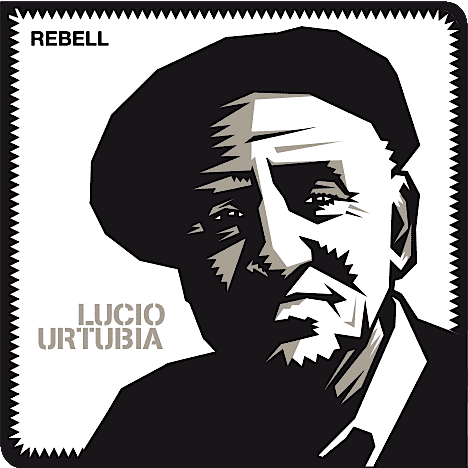

Diskussion ¬