
Redaktion – 12. Februar 2025

Albanien galt als das Leuchtfeuer des Sozialismus in Europa. Wie konnte es dennoch zur revisionistischen Entartung und schließlich zur Rückkehr zum Kapitalismus kommen? Eine Artikelserie des Roten Morgen, die wir im Mai, Juni und Juli 1991 veröffentlichten, befasste sich mit den damaligen Entwicklungen und warf in diesem Zusammenhang einige grundsätzliche Fragen zum Sozialismus auf.
.
Die Revisionisten Alia & Co. –
Feinde des albanischen Volkes
Die Wahlen in Albanien mögen vordergründig wie ein Erfolg der PAA aussehen: Sie konnte zwei Drittel der Parlamentssitze gewinnen. Auch wenn diese für die PAA günstige Sitzverteilung aufgrund des Mehrheitswahlrechts zustande kam: Immerhin erhielt die PAA 56 % der abgegebenen Stimmen. Allerdings erhielt sie diese Stimmen vorwiegend auf dem Land, während sie in städtischen Gebieten der „Demokratischen Partei“ meist unterlag. Ramiz Alia fiel beispielsweise in Tirana mit Pauken und Trompeten durch. Es waren nur noch sehr wenige Arbeiter, die für die Kandidaten der PAA stimmten.
Das kam für uns nicht überraschend: Bereits im letzten Jahr hatte die Reisegruppe der KPD in den albanischen Betrieben, die sie besuchte, feststellen müssen, dass die Masse der Arbeiter die PAA – teils sehr schroff – ablehnte. Und aus den Nachrichten mussten wir entnehmen, dass sich unwürdige Szenen abspielten, sobald beispielsweise in Dürres auch nur das Gerücht aufkam, ein Schiff werde vor Anker gehen, mit dem man Albanien verlassen könne. „Bloß weg von hier“ – das war für Zehntausende die Devise. Und das waren keine Zehntausende von Lumpenproletariern und Kriminellen, das waren auch nicht vorwiegend Bauern oder Intellektuelle – das waren vorwiegend Arbeiter. Ganz offensichtlich hat die Masse der albanischen Arbeiter nicht das Bewusstsein, die herrschende Klasse zu sein.
Wollte man albanischen Arbeitern erzählen, die Diktatur, die in Albanien ausgeübt werde, sei ihre Diktatur, eine Diktatur der Arbeiterklasse, so würde man in aller Regel – je nach Temperament – entweder Hohn und Spott oder Prügel ernten. Kann man aber annehmen, die Arbeiterklasse sei in Wirklichkeit die herrschende Klasse, sie habe es nur nicht bemerkt? Es liegt auf der Hand, dass eine solche Annahme absurd wäre. Wenn die Masse der Arbeiter das Bewusstsein hat, sie hätten nichts zu verlieren, sie seien besitzlos, rechtlos, unterdrückt, dann kann dies nur daran liegen, dass das tatsächlich so ist! Und dies wiederum liegt keineswegs daran, dass die Revisionisten Alia und Co. daran gehen, den Begriff der Diktatur des Proletariats nunmehr auch offiziell zu begraben, wie das einst auch Chruschtschow getan hat. Dieses offizielle Begräbnis ist lediglich der Schlusspunkt einer Entwicklung, die die albanische Arbeiterklasse von der führenden Klasse des Landes zu einer ausgebeuteten und unterdrückten Klasse gemacht hat.
.
Die Arbeiterklasse hat ihre Vorhutpartei verloren
Wenn die albanischen Arbeiter nichts von der PAA halten, so beruht dies offensichtlich auf Gegenseitigkeit. Die Unzufriedenheit und der wachsende Widerstand der Arbeiter wurden von Staat und Partei offenbar bis zuletzt mit Phrasen wie „Das seien alles nur Kriminelle“ unter den Teppich gekehrt, anstatt zu fragen, welche Umstände es waren, die die Klasse von ihrer Partei entfernten. Man erinnert sich an die Erklärung der SED-Führer nach dem 17. Juni 1953, das Volk habe das Vertrauen der Regierung verloren, und an Brechts ironische Bemerkung, dann sei es wohl besser, dass die Regierung das Volk auflöse und ein besseres wähle.
Die PAA hat heute jeden Gedanken daran, die Arbeiterklasse zu befähigen, eine führende Stellung in der Gesellschaft einzunehmen, radikal aufgegeben; nicht einmal Phrasen sind davon übrig geblieben. Im Wahlprogramm erklärte die PAA, „ihr grundlegendes Ziel sei die Sorge für den Menschen, seinen Wohlstand, die Schaffung notwendiger Bedingungen, um die materiellen und geistigen Bedürfnisse des Volkes zu befriedigen“. Also: Die Partei „sorgt für den Menschen“, anstatt die Selbsttätigkeit der Gesellschaftsglieder anzusteuern, anstatt dafür zu kämpfen, dass jede Köchin den Staat regieren kann, wie Lenin dies gefordert hat. Ebenso wie Ulbricht und Honecker konnten sich auch Alia und Co. keine Zukunft vorstellen und wollten keine Zukunft, in der nicht alle gesellschaftlichen Entscheidungen in ihren Händen monopolisiert waren.
Das läuft der Leninschen Forderung diametral entgegen: „Der Kommunismus sagt: Die Avantgarde des Proletariats, die Kommunistische Partei, führt die parteilose Masse der Arbeitenden, indem sie diese Masse, zuerst die Arbeiter und dann auch die Bauern, aufklärt, schult, bildet und erzieht (‚Schule des Kommunismus‘), damit sie dahin gelangen können und wirklich gelangen, die Leitung der gesamten Volkswirtschaft in ihren Händen zu konzentrieren.“ (Lenin, Werke Bd. 32, S. 34)
Die Vorstellung von der Partei, die „für die Massen sorgt“, erinnert stattdessen an den Ausspruch des polnischen Revisionisten Gierek: „Wir werden gut regieren, und ihr werdet gut arbeiten.“
Und da die Revisionisten Alia und Co. jeden Gedanken an die Mobilisierung der Arbeiterklasse zur gesellschaftlichen Planung, Leitung und Kontrolle der Produktion aufgegeben haben, betrachten sie den Sozialismus konsequenterweise als ein „überholtes Modell“. Die PAA kämpft zwar um die Macht, doch die Machterhaltung ist Selbstzweck, soll lediglich die Pfründe einer privilegierten Schicht verteidigen und hat mit den Interessen der Arbeiterklasse, mit der Verteidigung des Sozialismus, nicht mehr das Geringste zu tun. Die PAA „zielte und zielt“ laut ihrem Wahlprogramm „auf den Aufbau einer gerechten und demokratischen Gesellschaft, wo jeder nach seiner Arbeit und seinem Beitrag für den Fortschritt der Gesellschaft gewürdigt und bezahlt wird. Sie hat versprochen, diese Werte zu bewahren und mit den Errungenschaften der Zivilisation der modernen Zeit zu bereichern.“
Wobei die Parteiführer es natürlich „gerecht und demokratisch“ finden, wenn sie ihre Machtstellung sichern und entsprechend gut bezahlt werden. Und wenn es dieser Sache dient, dann mögen eben auch offene Antikommunisten an der Macht beteiligt werden; warum soll einen das stören, wenn man sich selbst von den Zielen und Idealen des Kommunismus endgültig verabschiedet hat? Diese offenen Antikommunisten werden schließlich auch dabei behilflich sein, die „Errungenschaften der Zivilisation der modernen Welt“, sprich: die Segnungen des Imperialismus, ins Land zu holen. Gestützt auf diese Segnungen hofft die herrschende Schicht, ihre Macht gegen die Arbeiterklasse verteidigen zu können.
Dass Albanien dabei von den geballten Batterien westlicher Wirtschaftsmacht industriell in Grund und Boden geschossen werden wird, dass jegliche eigenständige Entwicklung der Wirtschaft unmöglich gemacht und Albanien wieder zum Armenhaus Europas werden wird, stört diese Herrschaften nicht. Sie sind somit nicht nur Verräter der Arbeiterklasse, sondern auch der albanischen Nation. Nicht nur, dass sie das Außenhandelsmonopol des Staates beseitigt haben, auch die freie Konvertierbarkeit des Lek ist im Wahlprogramm vorgesehen. Doch all dies hat seine Logik: Wenn Alia und Co. jeden Gedanken daran, sich auf die Arbeiterklasse zu stützen, aufgegeben haben, bleibt ihnen keine andere Möglichkeit, als sich auf den Imperialismus zu stützen und mit der Reaktion zu paktieren.
Der tiefe Graben zwischen der PAA und der albanischen Arbeiterklasse kann nicht erst dadurch hervorgerufen worden sein, dass sich durch die Veränderung der internationalen Lage die wirtschaftliche Situation schlagartig verschlechtert hat. Gewiss, eine solche Veränderung hat stattgefunden. Der Zusammenbruch der revisionistischen Länder und der Wegfall des Staatshandels, den Albanien mit diesen Ländern gepflegt hat, gab dem westlichen Imperialismus die Möglichkeit, den ökonomischen Druck auf Albanien massiv zu verstärken. Doch auch früher hatte Albanien schon sehr schwierige Situationen erlebt, zum Beispiel als Chruschtschow versuchte, Albanien zu erpressen und zusammen mit dem westlichen Imperialismus in die Zange zu nehmen. Enver Hoxha hatte damals gesagt, die Albaner würden lieber Gras essen, als sich zu beugen. Und das war damals keine Phrase: Es entsprach der Einstellung des größten Teils des Volkes, und die führende Kraft dieses Volkes war damals die Arbeiterklasse.
Der äußere Faktor, der gestiegene Druck des Imperialismus, kann nicht die letztlich entscheidende Ursache für den Untergang des Sozialismus sein. Dieser äußere Faktor hätte zwar zur Notwendigkeit gewisser Kompromisse, vor allem im ökonomischen Bereich, führen können. Es ist nicht prinzipiell falsch, auch ausländisches Kapital zur Entwicklung der Produktivkräfte zu nutzen, wenn die Lage dies erfordert: Schon Lenin hatte während der sogenannten Neuen Ökonomischen Politik (NÖP) zu diesem Mittel gegriffen. (Am Außenhandelsmonopol des proletarischen Staates hielt er freilich unter allen Bedingungen eisern fest.)
Doch Alia und Co. geht es nicht darum, Kompromisse zu machen, um einen Kernbereich des Sozialismus zu verteidigen. Ihnen geht es allein um die Sicherung ihrer Macht und ihrer Stellung. Die plötzliche massive Verschlechterung der äußeren Lage Albaniens und die daraus folgenden wirtschaftlichen Probleme haben die tiefe Kluft zwischen der PAA und der albanischen Arbeiterklasse lediglich schlagartig und plötzlich in Erscheinung treten lassen. Doch dem muss eine längere Entwicklung vorangegangen sein, die dazu geführt hat, dass die albanischen Arbeiter keine Partei mehr haben und deshalb den Einflüssen des Imperialismus unterliegen. Gewiss ist es unwürdig, wenn breite Massen der albanischen Arbeiter das Heil vom Imperialismus erwarten. Man darf aber nicht vergessen, dass diese Haltung schon längere Zeit von der PAA gezüchtet wurde, die dem Imperialismus offenbar mehr vertraute als der Klasse, deren Partei sie angeblich war. Zuerst wurde die Aufklärung über den Imperialismus, seine Interessen und aggressiven Absichten, immer mehr abgeschwächt, dann wurde sie eingestellt, und heute lobt die PAA den Imperialismus in solchen Tönen, dass es manchem Sozialdemokraten bei uns schon peinlich wäre. In ihrem Wahlprogramm erklärte die PAA beispielsweise, sie werde „Anstrengungen machen, dass Albanien an all den fortschrittlichen Prozessen in der Welt teilnimmt, die zur Stärkung des Friedens und der Sicherheit, der gleichen Zusammenarbeit unter den Völkern und der Emanzipation der Menschen beitragen würden“, wobei als Beispiel dann die Prozesse der europäischen Sicherheit und Zusammenarbeit genannt werden (gemeint ist hier die KSZE). Der Imperialismus als Garant für die Emanzipation der Menschheit! Weiter geht die PAA laut ihrem Wahlprogramm „von dem Standpunkt aus, dass europäische Sicherheit eine allgemeine Sicherheit sein sollte, für die großen und kleinen Länder, dass sie schnellere Fortschritte machen sollten, die Teilungen und Spaltungen zu überwinden, die in der Zeit der Blöcke und durch den Kalten Krieg geschaffenen schädlichen Mentalität entspringen. Das sollte von einer allseitigen ökonomischen Zusammenarbeit begleitet sein, die dazu beiträgt, die Unterschiede der Entwicklung zu verringern, die Möglichkeiten zu schaffen, dass alle Völker unseres Kontinents sich der Segnungen der gegenwärtigen Fortschritte erfreuen können.“
Wenn also die angebliche Partei der Arbeiter verkündet, der Imperialismus werde dem kleinen Albanien Frieden und Wohlstand sichern, dann sollte man es sich gut überlegen, ob man Steine auf albanische Arbeiter wirft, die sich gegen die PAA erheben, weil sie die Illusion haben, bei jeder anderen Herrschaft – auch der des Imperialismus – könne es nur noch besser werden.
.
Wie kam es zur revisionistischen Entartung?
Doch welcher Art war diese längere Entwicklung, die die albanische Arbeiterklasse ihrer Vorhutpartei beraubt und damit politisch und ideologisch wehrlos gemacht hat? Wir sind derzeit nicht in der Lage, diese Entwicklung anhand von empirischem Material präzise nachzuvollziehen: Teils fehlt es uns an Material, teils haben wir das vorhandene Material noch nicht genügend ausgewertet. Wir haben aber einige Schlussfolgerungen aus der Entartung ehemals sozialistischer Länder gezogen und wissen insbesondere einiges über diese Entwicklung in der DDR, wobei viele Erscheinungen in der DDR mit heutigen Erscheinungen in Albanien recht genau übereinstimmen. Auf dieser Grundlage lassen sich einige Schlüsse über die allgemeinen Ursachen der revisionistischen Entartung in Albanien ziehen und einige Vermutungen über konkrete Ursachen anstellen, wobei es erforderlich ist, diese Dinge weiter zu untersuchen und die Schlüsse zu überprüfen und zu konkretisieren.
Vor allem ist es notwendig, den Sozialismus als eine Übergangsgesellschaft zu begreifen, die Muttermale der alten, der kapitalistischen Gesellschaft neben Keimen des zukünftigen Kommunismus enthält. Diese Gesellschaft führt keineswegs automatisch und im Selbstlauf zum Kommunismus; kommt es zur Stagnation des Fortschritts in Richtung Kommunismus, so bedeutet dies auf die Dauer, dass die Muttermale der alten Gesellschaft ausgeweitet werden. Orientierung auf den Kommunismus heißt aber auch, dass die Selbsttätigkeit der Gesellschaftsglieder immer mehr gestärkt wird. Der sozialistische Staat und die führende Rolle der kommunistischen Partei müssen also darauf ausgerichtet sein, diese Selbsttätigkeit zu fördern, anstatt sie abzuwürgen. Doch dieser Übergang ist stets sehr schwierig, denn er bedeutet, dass die Unterschiede von Kopf- und Handarbeit, besonders von leitender und ausführender Tätigkeit, nach und nach eingeschränkt werden mit dem Ziel, sie letztlich zu überwinden. Besonders schwierig ist dieser Weg in einem Land mit schwach entwickelten Produktivkräften, und Albanien musste sich diesbezüglich geradezu aus dem Mittelalter herausarbeiten. Es kommt hinzu, dass die Arbeiterklasse in einem Land mit überwiegender Bauernschaft beträchtliche Kompromisse eingehen muss, um das Bündnis mit den Bauern nicht zu gefährden. All diese Faktoren hemmen das Voranschreiten zum Kommunismus. Trotz dieser enormen Schwierigkeiten hat es die PAA unter Führung von Enver Hoxha lange Zeit verstanden, eine enge Verbindung mit der Arbeiterklasse und dem Volk zu halten und das Entstehen einer verspießerten, bürokratischen, privilegierten Funktionärsschicht, die die Basis für den Revisionismus darstellt, zu hemmen.
Tendenzen zum Entstehen einer solchen Schicht gibt es in der Übergangsgesellschaft immer, und zwar deshalb, weil es eben noch Spezialisten für leitende Tätigkeiten geben muss, weil noch nicht ausnahmslos alle Werktätigen zur Leitung von Produktion und Gesellschaft herangezogen werden können. Gleichzeitig besteht noch nicht die Möglichkeit der Verteilung nach den Bedürfnissen, wie das im Kommunismus sein wird, sondern die Notwendigkeit der Entlohnung nach Leistung. Es ist gar nicht zu vermeiden, dass die Spezialisten für Kopfarbeit und besonders für leitende Tätigkeiten besser entlohnt werden, und dies verfestigt die bestehenden Klassenstrukturen, anstatt sie aufzuheben.
In der sozialistischen Sowjetunion hatte das zu enormen Lohnunterschieden, zu sehr hohen Gehältern der leitenden Kader der Nomenklatura geführt. Nach der bitteren Erfahrung der revisionistischen Entartung der Sowjetunion achtete die PAA unter Führung Enver Hoxhas darauf, dass die Lohnunterschiede in Albanien nicht zu hoch wurden.
Doch die Bildung einer privilegierten Schicht ist schwer zu verhindern, wenn man in der Aufhebung der Teilung der Arbeit nicht zügig voranschreiten kann, was in Albanien wegen des wenig entwickelten Standes der Produktivkräfte wiederum sehr schwer war. Nicht nur die offiziellen Löhne bzw. Gehälter spielen hier eine Rolle. Es besteht auch die Gefahr der Bildung von Seilschaften; man verschafft sich gegenseitig Vorteile. Das geschieht durchaus nicht notwendigerweise in subjektiv feindlicher Absicht: Bei der Besetzung von wichtigen Funktionen bevorzugt man natürlich zuverlässige Menschen, später aber kann es schon dazukommen, dass man jemanden bevorzugt, weil er „aus guter Familie“ kommt, weil die Eltern Parteimitglieder sind usw. Hier zählen also bereits nicht mehr eigene Verdienste, sondern hier zählt, ob man in eine bestimmte Schicht hineingeboren wird. In Albanien wurden viele Maßnahmen getroffen, um gegen solche Dinge zu kämpfen. Den Bürokratismus kann man freilich nicht ausrotten, solange es noch Klassenunterschiede gibt, doch man kann ihn bekämpfen. Solange vorwiegend solche Menschen in der Partei sind, die nicht nur marxistisch-leninistische Begriffe im Munde führen, sondern die Arbeiter und übrigen Werktätigen mobilisieren, solange die Kommunisten wirklich darum kämpfen, dass möglichst viele – auch parteilose – Arbeiter real eine leitende Rolle im Betrieb und im Staat einnehmen, werden die Arbeiter durchaus verstehen, dass es daneben unvermeidlich auch Missstände, Bürokratismus, Kommandowirtschaft geben muss, dass man diese Dinge nicht von heute auf morgen beseitigen kann.
Wenn aber immer mehr Kommunisten immer selbstzufriedener werden, mehr von der Diktatur des Proletariats reden, als wirklich für eine führende Rolle von Arbeitern in allen gesellschaftlichen Bereichen zu kämpfen, mehr von Kommunismus reden, als wirklich für die Beseitigung von Privilegien, Seilschaften und dergleichen zu kämpfen, dann wird bei der Masse der Arbeiter immer weniger die Bereitschaft da sein, sich um gesellschaftliche Angelegenheiten zu kümmern.
All dies führt nicht von heute auf morgen dazu, dass die Autorität der Partei verlorengeht, dass die Menschen den Sozialismus ablehnen. Solange die wirtschaftliche Situation erträglich ist, werden viele die Dinge hinnehmen, mit dem Staat zufrieden sein, ihn aber nicht als ihren Staat betrachten, sondern eher sagen: „Die Kommunisten machen das ganz gut.“
Entwickeln sich die Dinge aber in eine solche Richtung, so geht die Orientierung auf die Selbsttätigkeit der Gesellschaftsglieder, auf den Kommunismus, nach und nach verloren. Und so entsteht ein Kreislauf, denn je schwächer die Initiative von unten wird, desto mehr scheint die Auffassung bestätigt zu werden, dass die Dinge nur dann laufen, wenn die Partei sich in alles und jedes unmittelbar einmischt, wenn die staatlichen Apparate und Einrichtungen die Dinge regeln usw. Umso wichtiger und „unentbehrlicher“ erscheinen dann die führenden Persönlichkeiten, und umso „berechtigter“ erscheint es, dass diese als Lohn für ihre „verantwortungsvolle Tätigkeit“ beträchtliche materielle Vorteile genießen. Die Gesellschaft bewegt sich dann nicht in Richtung Beseitigung, sondern in Richtung Verfestigung der Klassen. Die demokratischen Rechte, die die sozialistische Rätemacht den Werktätigen garantiert, bleiben immer mehr auf dem Papier stehen. Natürlich hat man bei Wahlen, Stellenbesetzungen usw. das formale Recht, die Personalvorschläge der Partei zu kritisieren. Doch wer das tut, gerät zunehmend in den Ruf, ein Querulant oder gar ein Feind zu sein.
Solche Verhältnisse können sich nach und nach innerhalb der sozialistischen Ordnung entwickeln, wenn die Wachsamkeit der Revolutionäre nachlässt, wenn eine gewisse Selbstgenügsamkeit eintritt, doch derartige Entwicklungen führen – wenn sie ein gewisses Maß überschritten haben – unweigerlich zum Revisionismus. Derartige Entwicklungen müssen in Albanien stattgefunden haben.
Zwar hatte Enver Hoxha, das negative Beispiel der Sowjetunion vor Augen, diese Gefahr gesehen, davor gewarnt und Maßnahmen dagegen getroffen; zur Entwicklung in der Sowjetunion hatte er treffend erklärt:
„Die Partei wurde von schwerem Rost, von politischer Apathie befallen; es machte sich die irrige Meinung breit, nur der Kopf, die Führung, habe zu wirken und alles zu lösen. Diese Auffassung führte dazu, dass es überall und bei allem hieß: ‚Die Führung weiß schon Bescheid‘, ‚Das Zentralkomitee irrt sich nicht‘, ‚Das hat Stalin gesagt, und fertig‘ usw. Vieles davon mag Stalin gar nicht gesagt haben, aber man versteckte sich hinter seinem Namen. Die Apparate und die Partei- und Staatsangestellten wurden ‚allmächtig‘, ‚unfehlbar‘, sie handelten bürokratisch und beriefen sich dabei auf den demokratischen Zentralismus, auf die bolschewistische Kritik und Selbstkritik, die in Wirklichkeit nicht mehr bolschewistisch war. Zweifellos büßte die Bolschewistische Partei so ihre einstige Lebenskraft ein. Sie bewahrte richtige Formeln, aber es waren eben nur Formeln; sie führte durch, war aber nicht selbstständig aktiv, die Arbeitsmethoden und -formen bei der Leitung der Partei führten genau zum Gegenteil. Unter diesen Verhältnissen begannen die bürokratisch-administrativen Maßnahmen über die revolutionären vorzuherrschen. Die Wachsamkeit war nicht mehr operativ, denn sie war nicht mehr revolutionär, auch wenn man davon tönte. Sie wurde von einer Wachsamkeit der Partei und der Massen zu einer Wachsamkeit der bürokratischen Apparate und verwandelte sich – wenn auch nicht völlig der Form nach, so doch faktisch – in eine Wachsamkeit des Staatssicherheitsdiensts und der Gerichte.“ (Enver Hoxha, Die Chruschtschowianer, Tirana 1980, S. 48 f.)
Und dennoch hatte die PAA keine vollständige theoretische Vorstellung von diesen Prozessen, insbesondere nicht von ihren sozioökonomischen, klassenmäßigen Wurzeln. Man ging beispielsweise davon aus, dass die antagonistischen Widersprüche „nicht auf die sozialistischen Produktionsverhältnisse zurückzuführen (sind), sondern ein Produkt der vorhandenen Muttermale aus der alten bürgerlichen Gesellschaft im Innern und des Drucks der kapitalistisch-revisionistischen Einkreisung von außen“ sind. (Wissenschaftliche Konferenz, Tirana 1984)
Sie sind natürlich Produkt der Muttermale der alten Gesellschaft, doch diese Muttermale wurzeln ja gerade innerhalb der sozialistischen Produktionsverhältnisse, da diese Produktionsverhältnisse die Arbeitsteilung zwischen Kopf- und Handarbeit beinhalten. Aus der falschen Vorstellung, diese Muttermale hätten keine Basis in den sozialistischen Produktionsverhältnissen, erwuchs wiederum die voluntaristische Illusion (Voluntarismus: die Vorstellung, man könne unabhängig von objektiven Umständen fast alles erreichen, wenn man es nur wolle), man könne die sich hieraus ergebenden Probleme vorwiegend mit Direktiven, Befehlen, staatlichen Maßnahmen und mit einer sehr formal verstandenen „führenden Rolle der Partei“ lösen, wodurch wiederum Methoden des Bürokratismus und des Kommandoregimes verstärkt wurden.
Wie schon gesagt, ergriff die PAA viele Maßnahmen, um gegen solche Tendenzen zu kämpfen, die die Einheit von Partei und Klasse beeinträchtigen konnten. Doch dieser Kampf stieß seinerseits wiederum auf Grenzen, die in theoretischer Hinsicht unter anderem in der unvollständigen Erkenntnis der Quelle antagonistischer Widersprüche, in einer unvollständigen Analyse der sozialistischen Produktionsverhältnisse wurzelten. Da die innere klassenmäßige Basis antagonistischer Widersprüche nicht richtig begriffen wurde, entstand eine gewisse Neigung, falsche Ideen mit Verboten zu bekämpfen; wird eine solche Neigung übermächtig, so wird die Orientierung auf die Selbsttätigkeit der Gesellschaftsglieder nachhaltig beeinträchtigt.
Die Initiative, die in den sechziger Jahren von revolutionären Jugendlichen ausging und auf die Schließung der Kirchen und Moscheen gerichtet war, war eine gute Sache, ein kräftiger Schlag gegen den reaktionären Einfluss, den die Pfaffen in der Gesellschaft ausübten. Doch kann das Verbot der Religionsausübung auf Dauer keine richtige Politik gewesen sein. Gibt es für die Religion erst einmal keine materielle Grundlage, so stirbt sie von selbst ab, man braucht sie dann nicht zu verbieten. In Albanien mit seinen relativ rückständigen Produktivkräften und seiner großen Bauernschaft musste es aber eine gewisse materielle Grundlage für die Religion geben; dann aber ist ein Verbot der Religionsausübung geeignet, die Religion zu stärken, gläubige Menschen gegen den Sozialismus aufzubringen.
Verboten waren aber beispielsweise auch Bücher von Sartre oder von Kafka. Dadurch freilich macht man solche Bücher erst interessant. Ein Verbot ist in der Regel unnötig und schädlich, denn der Marxismus hat zumindest unter der Arbeiterklasse genug Lebenskraft, um bürgerlichen Ideen entgegenzutreten, wenn man ihn nur richtig zu handhaben versteht. Und Teile der Intelligenz und der Bauernschaft werden aufgrund ihrer Lebenslage auch mit den besten Argumenten ebenso wie mit den schärfsten Verboten nicht zu „überzeugen“ sein. Durch ein Verbot erweckt man den Eindruck, die Marxisten seien nicht in der Lage, sich gegen die Ideen zur Wehr zu setzen, die in solchen Büchern verbreitet werden. Ganz schlecht ist es, wenn Parteifunktionäre und Familienmitglieder von Parteifunktionären solche Bücher besitzen dürfen, andere aber nicht, wie es zumindest ab einem bestimmten Zeitpunkt der Fall war. Bekämpft man bürgerliche Ideen vorwiegend durch Verbote statt durch die wissenschaftlichen Ideen des Marxismus-Leninismus, so geht auch unter diesem Gesichtspunkt die Orientierung auf die Selbsttätigkeit der Gesellschaftsglieder immer mehr verloren. Die Funktionäre des Staates und der Partei erscheinen immer mehr als die Hüter ewiger Wahrheiten, die zu bestimmen haben, was richtig und was falsch ist. Der Marxismus ist die revolutionärste Theorie, die am meisten am realen Leben orientierte Erkenntnismethode, die die Menschheit hervorgebracht hat, doch er wird so seines Wesens beraubt, in ein totes Dogmensystem, eine Religion verwandelt.
Bezeichnend ist der Hinweis von Ismail Kadare, man hätte gegen seinen Roman „Der große Winter“ eine Kampagne durchgeführt, und er wäre damals öfter verwundert gefragt worden, ob er denn nicht im Gefängnis sei. Diese Kampagne sei erst dann schlagartig beendet worden, als Enver Hoxha erklärt habe, das Buch sei doch gar nicht schlecht. Den Kräften des Apparats passte es offenbar nicht, dass in diesem Roman konkrete Menschen, die durch die widersprüchliche Klassenrealität der Übergangsgesellschaft geformt worden waren, geschildert wurden, anstatt abstrakter „sozialistischer“ Heroen.
Aber was müssen da bereits für Verhältnisse geherrscht haben, dass nur das Eingreifen Enver Hoxhas eine derartige Kampagne beenden konnte! Die Verhältnisse müssen schon sehr ähnlich gewesen sein wie in der Sowjetunion Stalins, wo oftmals auch nur das persönliche Eingreifen Stalins das Schlimmste verhindern konnte. (Dies ergibt sich aus zahlreichen Stellen der Stalin-Werke, aus denen hervorgeht, dass Menschen zu Unrecht von bürokratischen Kräften angegriffen oder kaltgestellt worden waren, sich vergeblich an zahllose Stellen der Partei oder des Staates gewandt hatten und erst rehabilitiert wurden, als sie sich an Stalin wandten.)
Derartige Verhältnisse treiben schwankende Intellektuelle wie Kadare letztlich auf die Seite der Konterrevolution, nachdem man sie zuvor längere Zeit vorwiegend mit materiellen Privilegien „bei der Stange gehalten hat“. (Was nebenbei gesagt auch nicht besonders gesund ist.) Die Arbeiterklasse kann ihre Hegemonie gegenüber den Intellektuellen und ihre Hegemonie (Vorherrschaft; führende Rolle) im geistigen und kulturellen Bereich nur ausüben, wenn die Kommunisten es verstehen, den Marxismus-Leninismus schöpferisch anzuwenden und seine Überlegenheit gegenüber bürgerlichen Ideen lebendig zu beweisen – zu zeigen, dass nur der Marxismus-Leninismus in der Lage ist, die Wirklichkeit, das Leben zu erklären und im Sinne der Arbeiterklasse und der ganzen fortschrittlichen Menschheit zu verändern.
.
Bündnis mit den Bauern und Hegemonie des Proletariats
Die Hegemonie des Proletariats ist überhaupt ein Dreh- und Angelpunkt bei der Frage der Verteidigung des Sozialismus. Das gilt auch und gerade in einem Land wie Albanien mit überwiegend bäuerlicher Bevölkerung, einem Land, in dem das Proletariat folglich seine Klassenherrschaft nur im Bündnis mit den Bauern ausüben kann. Die kommunistische Partei darf bei aller notwendigen Bündnispolitik nicht vergessen, dass der Sozialismus nicht behauptet werden kann, wenn sich in der ganzen Lebensweise der Menschen nicht nach und nach – und sei es auch noch so langsam – kommunistische Elemente entwickeln. Es ist die Arbeiterklasse, deren objektives Klasseninteresse auf den Kommunismus gerichtet ist. Es ist die Arbeiterjugend, die am ehesten bereit ist, solchen Entwicklungen den Weg zu bahnen.
Doch nach unseren Beobachtungen hat es die PAA offenbar in den letzten Jahren immer weniger verstanden, die Jugend für kommunistische Ziele und Initiativen zu begeistern und zu mobilisieren. Sie tat es am besten, solange es darum ging, die größte Not, das größte Elend zu bannen: dem Volk Brot zu schaffen, durch Trockenlegung der Sümpfe die Malaria zu besiegen, den Analphabetismus zu überwinden, die Frau vom Schleier und anderen extremen Formen der Herrschaft des Patriarchats zu befreien usw. Doch irgendwann tritt ein Punkt ein, an dem die elementaren Bedürfnisse grundsätzlich befriedigt sind, an dem sich die Frage stellt: Wird die Revolution weitergeführt? Wälzt der Mensch mit den Umständen seine eigene Tätigkeit, sich selbst, um?
(Marx: „Das Zusammenfallen des Änderns der Umstände und der menschlichen Tätigkeit oder Selbstveränderung kann nur als revolutionäre Praxis gefasst und rationell verstanden werden.“ MEW 3, S. 6)
Oder werden letztlich die Produktionsverhältnisse und auf dieser Grundlage die ganze Lebensweise der alten Gesellschaft reproduziert? Der Sozialismus muss sich zwangsläufig verändern – sei es in die eine oder in die andere Richtung. Er ist eine Übergangsgesellschaft und kann nicht einfach seine eigenen Zustände ständig reproduzieren, denn diese Zustände enthalten Elemente des Alten neben Keimen des Neuen.
In einer Gesellschaft mit relativ schwach entwickelten Produktivkräften ist es freilich schwer, stets die Initiative zu behalten, stets neue Keime des Kommunismus zu entwickeln (und sei es auch in noch so bescheidenem Ausmaß). Doch wenn man die Initiative verliert, verliert man das Proletariat und die Jugend und kann den Sozialismus nicht behaupten. Es ist gerade für uns sehr wichtig, zu studieren, wie die PAA diesbezüglich nach und nach die Initiative verloren hat. Denn bei uns, bei entwickelten Produktivkräften, wird sich nach dem Sieg der proletarischen Revolution von Anfang an viel schärfer die Frage stellen: Werden Keime der kommunistischen Produktions- und Lebensweise entwickelt, oder setzt sich der Kapitalismus wieder durch?
Die Phase, in der die revolutionäre Begeisterung sich an Kampfzielen entfaltet und behauptet, die sich auf die Befriedigung der elementarsten Bedürfnisse des Volkes beziehen, wird sehr viel kürzer sein. Mehr noch: Bereits heute stellt sich für uns in der Tagespolitik die Aufgabe, Elemente des Kommunismus als Kampfziele zu entwickeln, die durch den hoch entwickelten Stand der Produktivkräfte objektiv auf die Tagesordnung gesetzt sind, aufgrund des kapitalistischen Charakters der Produktionsverhältnisse aber nicht verwirklicht werden können. Dies ist eine Frage der revolutionären Führung des Tageskampfes, der Frage, den Kampf um unmittelbare Interessen so zu führen, dass die kapitalistischen Produktionsverhältnisse durch diesen Kampf angegriffen werden.
Und der Kampf um diese unmittelbaren Interessen ist eben nicht immer in erster Linie ein Kampf gegen den Hunger. Auch wenn 10 % der Menschen unter dem offiziellen Existenzminimum vegetieren, sind Hunger und Obdachlosigkeit heute bei uns sicher nicht das Hauptproblem für die Massen. Das kann sich ändern, eine revolutionäre Situation kann (aber muss nicht) auf der Grundlage entstehen, dass diese Probleme wieder zum Hauptproblem werden. Aber unsere Aufgabe ist es heute, unter heutigen Bedingungen revolutionäre Politik zu machen.
(Diese Zusammenhänge sollen hier nur angedeutet werden, doch müssen sie weiterverfolgt und weiter untersucht werden, um nach und nach eine kommunistische Tagespolitik entwickeln zu können, die in der Lage ist, breite Massen anzusprechen. Eine solche Politik muss auf Grundlage der heutigen Bedingungen entwickelt werden und nicht auf der Grundlage der Bedingungen der Weimarer Zeit oder des vorrevolutionären und revolutionären Russlands – was wir sicherlich nicht ausreichend getan haben. Hier dürfte eine Quelle unserer Einflusslosigkeit liegen.)
Die PAA hat in ihrer Politik stets sehr stark den nationalen Faktor betont. Dies war zweifellos richtig, doch muss man sehen, dass die starke Betonung der nationalen Frage dem Wesen der Sache nach Bündnispolitik gegenüber den Bauern war. Für das klassenbewusste Proletariat bedarf es keiner nationalen Politik, um den Sozialismus zu verteidigen. Es verteidigt den Sozialismus, weil es seine Klasseninteressen verteidigt.
Das heißt aber andererseits: Wenn die Arbeitermassen den Klassenstandpunkt verloren haben, dann hilft auch keine nationale Politik mehr. Und genau dies muss die PAA heute erfahren. Die Bauern wählen selbst heute noch die PAA, weil sie zu Recht Angst haben, dass das Eindringen des Imperialismus nach Albanien ihre Existenz vernichten wird (und sie sind die Betrogenen, weil die PAA das Eindringen des Imperialismus in Wirklichkeit fördert). Sie haben etwas zu verlieren, während die Arbeiter davon ausgehen, dass sie nichts zu verlieren haben – wobei sie sich dabei allerdings ebenfalls täuschen. Denn das Kapital wird die Lebensbedingungen der albanischen Arbeiter nicht etwa verbessern, sondern drastisch verschlechtern.
Das Proletariat ist gerade deshalb die revolutionäre Klasse, weil es keiner Umwege bedarf, um es in den Dienst einer emanzipatorischen Bewegung zu stellen. Die Proletarier werden durch den Kapitalismus so zu Boden gedrückt, dass sie gezwungen sind, sich zur herrschenden Klasse zu erheben, um sich selbst und damit die Menschheit von der Unterordnung unter die Notwendigkeiten der Kapitalverwertung zu befreien. Wenn die albanischen Proletarier davon ausgehen, dass sie nichts zu verlieren haben, so zeigt dies sehr deutlich, dass sie ihre Rolle als herrschende Klasse eingebüßt haben.
Nach unseren Erfahrungen scheint es auch beim Kampf um die vollständige Befreiung der Frau nach und nach zu einer Stagnation gekommen zu sein. Auch dieser Kampf ist ein spezifisches Anliegen des klassenbewussten Proletariats, welches keinerlei Interesse an irgendwelchen sozialen Unterschieden zwischen den Geschlechtern hat, während das Patriarchat mächtige historische Wurzeln in der bäuerlichen Großfamilie hat, die bereits in den Ausläufern der Urgesellschaft begründet sind. In einem Bauernland muss die Arbeitermacht derartigen bäuerlichen Traditionen Rechnung tragen, darf sie die Entwicklung nicht überspitzen, um die Einheit der Werktätigen, die für die Verteidigung des Sozialismus erforderlich ist, nicht zu gefährden.
Erscheinungen wie das Verbot der Abtreibung, die Unmöglichkeit, dass Frauen sich in Cafés aufhalten etc. mögen – so reaktionär sie sind – daher eine zeitweilige, relative Berechtigung haben. Doch soweit wir es beurteilen können, waren solche Erscheinungen in der öffentlichen Diskussion in Albanien bis zuletzt ein Tabuthema. Dies aber ist bereits der Keim zu einem Aufgeben der Initiative, denn wenn das Proletariat gegenüber seinem Bündnispartner Zugeständnisse macht, so darf es seine eigene Klassenlinie, seine Ideologie nicht aufgeben, muss Kompromisse klar als Kompromisse kennzeichnen, anstatt sie als „Wille des Volkes“ zu verklären.
Geschieht dies aber in dem einen oder anderen Punkt, so wird das Proletariat von der rückständigen Mentalität anderer Schichten infiziert und letztlich seiner Hegemonie-Rolle beim Kampf um die Emanzipation der Menschheit beraubt. Die Politik der moralisch-politischen Einheit des Volkes wird, wenn man die Einheit verabsolutiert, von einem Mittel der Ausübung der Hegemonie des Proletariats zu einem Mittel der Beseitigung dieser Hegemonie. Dies gilt im Verhältnis Proletariat – Intelligenz wie auch im Verhältnis Proletariat – Bauern.
Diese wenigen Beispiele sollen hier stellvertretend für die allgemeine Frage stehen: Ist es im Laufe der Zeit möglicherweise zu einer gewissen Verabsolutierung des Begriffs des Volkes, und das heißt vor allem zu einer gewissen Verabsolutierung des Bündnisses mit den Bauern gekommen? Die gewaltige Bedeutung, die der Leninismus der Frage des Bündnisses mit den Bauern, und zwar besonders in rückständigen Ländern, beimisst, misst er ihr zweifellos zu Recht bei. Eine Verabsolutierung tritt aber ein, soweit man aus den Augen verliert, dass dieses Bündnis ein Bündnis bei führender Rolle der Arbeiterklasse sein muss; Fehler in dieser Richtung würden dem Kern, dem Wesen des Leninismus gerade zuwiderlaufen! Auf den ersten Blick könnte es scheinen, als würde die Tatsache, dass „linke“ Experimente auf dem Gebiet der Landwirtschaft, die bekanntlich zur willkürlichen Massenschlachtung von Vieh und zur Fleischknappheit führten, gegen die Annahme sprechen, dass die proletarische Partei zu viel Rücksicht auf die Bauern als Bündnispartner genommen habe und dass dies eine Entwicklungslinie sei, die dazu geführt habe, dass sie ihren Charakter als proletarische Partei schließlich eingebüßt habe.
Doch diese Annahme kann dennoch zutreffen. Sowohl rechte als auch „linke“ Fehler in Bezug auf die Frage des Bündnisses mit den Bauern können eine gemeinsame theoretische Grundlage darin haben, dass die bestehenden Klassengegensätze unterschätzt und die begriffliche Abstraktion des „Volkes“ zunehmend verabsolutiert wurde. Dies kann gleichzeitig dazu führen, dass die ökonomische Politik zu wenig Rücksicht auf die Interessen der Bauern nimmt, während in ideologischen und politischen Fragen zu wenig darauf geachtet wird, den spezifischen Klassenstandpunkt des Proletariats (notwendigenfalls auch in Abgrenzung zu den Bauern und natürlich auch zur Intelligenz) zu formulieren und – entsprechend den objektiven Möglichkeiten und Kräfteverhältnissen – nach und nach durchzusetzen, was aber unbedingt erforderlich ist, um die strategische Orientierung auf den Kommunismus zu wahren und damit den Sozialismus zu behaupten.
Denn Sozialismus ist dem Wesen der Sache nach strategische Orientierung auf den Kommunismus, wobei der Klassencharakter dieser Orientierung proletarisch ist. Jede unzulässige Abschwächung der Hegemonie des Proletariats ist somit eine Abschwächung der Orientierung auf den Kommunismus und höhlt den Sozialismus aus.
Notwendige Kompromisse im Bereich der Ökonomie und ggf. auch im Bereich der Politik dürfen keineswegs zu Zugeständnissen im Bereich der Ideologie, also zur Abschwächung des proletarischen Klassenstandpunkts, führen. Dies beinhaltet unter anderem, dass Kompromisse jederzeit als solche gekennzeichnet werden müssen.
.
Gegen Subjektivismus und Objektivismus!
In der Analyse des Sozialismus einerseits und des Revisionismus andererseits seitens der Marxisten-Leninisten war lange Zeit der Subjektivismus vorherrschend, d.h. es wurden vorwiegend (mitunter sogar fast ausschließlich) subjektive Faktoren gesehen, die den Übergang zum Revisionismus ermöglicht bzw. begünstigt haben: Fehler der Marxisten-Leninisten, das Bedürfnis von Bürokraten nach Privilegien, das Abweichen von der marxistisch-leninistischen Theorie, der Verrat revisionistischer Führer. Bei einer solchen Betrachtungsweise erscheint der Revisionismus als subjektiv bedingter Betriebsunfall der Geschichte. Eine solche Betrachtungsweise ist idealistisch, denn sie macht subjektive Betrachtungen, Vorstellungen, Bestrebungen usw., die aus dem Zusammenhang der objektiven Entwicklung einer sozialistischen Gesellschaft herausgelöst und damit verabsolutiert werden, in dieser verabsolutierten Form zum Motor der Geschichte. Eine solche Methode ist unmarxistisch.
Eine Reaktion auf subjektivistische Fehler kann der Objektivismus sein. Dieser erkennt nur oder fast nur objektive Faktoren der Entartung eines sozialistischen Landes an, seien sie innerer oder äußerer Natur. Die Methode des Objektivismus ist nicht weniger unmarxistisch als die des Subjektivismus, denn der Marxismus erkennt durchaus an, dass das subjektive Handeln der Menschen in gewisser Weise Motor der Geschichte ist: Die Menschen sind Produkt der gesellschaftlichen Verhältnisse, doch beim Übergang zum Kommunismus verändern sie – auf der Grundlage objektiv wirkender Gesetze – diese Umstände und damit sich selbst. Marx: „Die materialistische Lehre von der Veränderung der Umstände… vergisst, dass die Umstände von den Menschen verändert… werden…“ (MEW 3, S. 5; mit „materialistischer Lehre“ ist hier der vormarxsche, nicht-dialektische Materialismus gemeint, in den der heutige Objektivismus zurückfällt.)
Gerade weil der Kommunismus eine Gesellschaft ist, in der die Menschen nicht blind wirkenden Gesetzen unterworfen sind, sondern die gesellschaftlichen Verhältnisse bewusst gestalten, spielt der subjektive Faktor beim Übergang zum Kommunismus eine gewaltige Rolle. Da aber die Masse der Bevölkerung die gesellschaftlichen Verhältnisse zunächst noch nicht gestaltet (auch wenn es immer mehr dahin kommen muss!), spielt das subjektive Verhalten der proletarischen Vorhutpartei und ihrer Führer eine bedeutende Rolle.
Die notwendige Kritik am Subjektivismus darf nicht dazu führen, dass diese Tatsache geleugnet wird. Das Falsche am Subjektivismus liegt nicht darin, dass er subjektiven Betrachtungen, Vorstellungen, Bestrebungen usw. innerhalb der Übergangsgesellschaft eine bedeutende Rolle zumisst, sondern darin, dass er diese losgelöst von den gesellschaftlichen Bedingungen, von der ökonomischen Basis betrachtet. Auf Grundlage der ökonomischen Basis der Übergangsgesellschaft entstehen jedoch sowohl Tendenzen, die auf den Kommunismus gerichtet sind, als auch Tendenzen, die den Revisionismus hervorrufen und auf die Restauration des Kapitalismus abzielen. Der subjektive Faktor – das Handeln der Menschen, der Klassenkampf – entscheidet, welche Tendenzen sich letztlich durchsetzen. Der Kommunismus kann sich aber nur dann durchsetzen, wenn die Menschen es immer besser lernen, den Produktionsprozess zu meistern. Mit anderen Worten: Beim Übergang zum Kommunismus wird der subjektive Faktor in immer stärkerem Maße Bestandteil der ökonomischen Basis. Diese Tatsache „übersehen“ sowohl der Subjektivismus als auch der Objektivismus, da beide mechanisch und nicht dialektisch sind.
Indem der Objektivismus die Bedeutung des subjektiven Faktors herabmindert, verharmlost er die Revisionisten und nimmt sie aus der Verantwortung für den Sturz des Sozialismus und die Restauration des Kapitalismus. Durch die objektivistische Betrachtungsweise scheinen auch die subjektiven Fehler von Marxisten-Leninisten denselben Stellenwert zu gewinnen wie der Verrat der Revisionisten, da ja angeblich ohnehin fast nur objektive Faktoren für den Verlauf der Dinge verantwortlich seien; die Trennungslinie zwischen Revolutionären und Konterrevolutionären wird so verwischt. Ferner wird die unversöhnliche Trennungslinie zu den Trotzkisten aufgeweicht, die schon immer gepredigt haben, dass der Sozialismus bei wenig entwickelten Produktivkräften oder in einem einzelnen Land nicht verwirklicht werden könne. Der Objektivismus ist also politisch äußerst gefährlich und kann sogar zum Einfallstor des Revisionismus und Trotzkismus werden.
.
Zur Frage der Produktivkräfte
Bisher hat der Sozialismus fast nur in rückständigen Ländern gesiegt (eine gewisse Ausnahme stellen die CSSR und die DDR dar), und in allen diesen Ländern hat sich schließlich der Revisionismus durchgesetzt. Damit stellt sich natürlich die Frage: Ist der Sieg des Revisionismus die (vielleicht sogar notwendige?) Folge der relativ wenig entwickelten Produktivkräfte? Kann der Sozialismus sich unter solchen Umständen überhaupt behaupten?
Marx/Engels schreiben dazu:
„Diese ‚Entfremdung‘, um den Philosophen verständlich zu bleiben, kann natürlich nur unter zwei praktischen Voraussetzungen aufgehoben werden. Damit sie eine ‚unerträgliche‘ Macht werde, d. h. eine Macht, gegen die man revolutioniert, dazu gehört, dass sie die Masse der Menschheit als durchaus ‚Eigentumslos‘ erzeugt hat und zugleich im Widerspruch zu einer vorhandenen Welt des Reichtums und der Bildung steht, was beides eine große Steigerung der Produktivkraft, einen hohen Grad ihrer Entwicklung voraussetzt – und andererseits ist diese Entwicklung der Produktivkräfte (womit zugleich schon die in weltgeschichtlichem statt die in lokalem Dasein der Menschen vorhandene empirische Existenz gegeben ist) auch deswegen eine absolut notwendige praktische Voraussetzung (des Kommunismus, d. Verf.), weil ohne sie nur der Mangel verallgemeinert, also mit der Notdurft auch der Streit um das Notwendige wieder beginnen und die ganze alte Scheiße sich herstellen müsste, weil ferner nur mit dieser universellen Entwicklung der Produktivkräfte ein universeller Verkehr der Menschen gesetzt ist…“
(Deutsche Ideologie, MEW 3, Seite 34 f.)
Unter den Bedingungen des vormonopolistischen Kapitalismus folgte hieraus, dass der Sieg des Sozialismus in wenig entwickelten Ländern unmöglich war: Der Kapitalismus war ja durchaus in der Lage, die Produktivkräfte weiterzuentwickeln und somit den Prozess weiter zu fördern, durch den einerseits die Masse der Bevölkerung eigentumslos wurde und andererseits die Voraussetzungen geschaffen wurden, beim Übergang zum Kommunismus nicht etwa nur den Mangel zu verallgemeinern. Dies aber hat sich mit dem Übergang des Kapitalismus in sein imperialistisches Stadium grundlegend geändert: Ein wenig entwickeltes Land hat heute kaum mehr die Chance, auf der Grundlage einer „normalen“ kapitalistischen Entwicklung die Produktivkräfte zu entwickeln, sondern es gerät unweigerlich unter die Vorherrschaft des Imperialismus, der es ausbeutet und gleichzeitig die eigenständige nationale Entwicklung der Produktivkräfte verhindert.
Albanien wäre geblieben, was es war – nämlich das Armenhaus Europas –, wenn dort nicht die Arbeiterklasse im Bündnis mit den Bauern die Macht ergriffen hätte. Erst auf der Grundlage der Diktatur des Proletariats, die sich von Anfang an bewusst das Ziel des Sozialismus setzte, war die gewaltige Entwicklung der Produktivkräfte möglich, die Albanien erlebt hat. Und umgekehrt: Die Restauration des Kapitalismus wird zur Herrschaft des Imperialismus führen, der vorhandene Produktivkräfte zerstören oder in jedem Fall ihre nationale Weiterentwicklung verhindern wird, sodass Albanien wieder zum Armenhaus Europas wird.
Mit anderen Worten: Unter den heutigen imperialistischen Bedingungen im Weltmaßstab muss in einem rückständigen Land nicht zuerst die kapitalistische Entwicklung die Masse der Bevölkerung als eigentumslos erzeugen und somit eine Macht schaffen, gegen die man revolutioniert, wie Marx sagte. Vielmehr kann es zu einer proletarischen Revolution kommen, ohne dass diese Voraussetzung gegeben ist. Das Ergebnis ist eine proletarische Macht, die rückständige Produktivkräfte vorfindet, also nicht die Bedingungen vorfindet, um zum Kommunismus voranzuschreiten. Sie muss diese Bedingungen, diese Produktivkräfte, selbst schaffen.
Das bestätigt glänzend den Hinweis von Marx bezüglich der Entwicklung der Produktivkräfte, die als weltgeschichtlicher Prozess die Voraussetzungen des Kommunismus schafft: Weltgeschichtlich war es sehr wohl die Entwicklung der Produktivkräfte – nämlich in den imperialistischen Metropolen –, die zu Bedingungen geführt hat, unter denen in einem unterentwickelten Land eine proletarische Macht siegen kann und siegen muss, um die weitere Entwicklung der Produktivkräfte in diesem Land zu ermöglichen. Also: Die proletarische Macht in einem solchen Land muss die Produktivkräfte, die das Voranschreiten zum Kommunismus erst ermöglichen, selbst schaffen.
.
Worin liegt der Revisionismus der PAA?
Nun kann freilich nicht bezweifelt werden, dass in Albanien eine Situation entstanden ist, in der die breite Mehrheit der Bevölkerung die Liquidation des Sozialismus entweder begrüßt oder ihr zumindest passiv gegenübersteht. Damit stellt sich die Frage: Gäbe es denn heute überhaupt noch eine Grundlage für eine Politik der Verteidigung des Sozialismus, selbst wenn sich in der PAA marxistisch-leninistische Kräfte durchgesetzt hätten, die eine solche Politik wollten? Denn es versteht sich von selbst, dass der Sozialismus nicht auf Dauer mit Gewalt gegen die Mehrheit der Bevölkerung gehalten werden kann; das wäre kein Sozialismus, keine strategische Orientierung auf den Kommunismus, also auf die Selbsttätigkeit der Gesellschaftsmitglieder.
Es ist objektiv möglich, bei dem niedrigen Stand der Produktivkräfte und der ungünstigen internationalen Lage dennoch einen sozialistischen Sektor der Industrie zu erhalten. Ein solcher sozialistischer Sektor der Industrie wäre nicht nur möglich, sondern er ist aus der Perspektive der weiteren Entwicklung der Produktivkräfte in Albanien notwendig. Eine subjektive Voraussetzung für die Verteidigung eines sozialistischen Sektors (auch wenn dieser neben kapitalistischen Sektoren der Volkswirtschaft existiert) ist, dass die Menschen mit einem bescheidenen Lebensniveau zufrieden sind, das sich nur langsam verbessert. (Der Kapitalismus und die Herrschaft des Imperialismus werden das Lebensniveau breiter Massen auf Dauer gründlich ruinieren, aber das ist ihnen offenbar nicht bewusst.) Ebenso müssten sie akzeptieren, dass sich die politische Situation, die Demokratie und das geistige Leben, die durch Bürokraten entstellt wurden, nur nach und nach verbessern werden. Denn bei einer optimalen Analyse und Politik durch die Partei könnten – vom gegenwärtigen Zustand ausgehend – auch hier keine großen Sprünge gemacht werden. Eine solche Geduld bringen die Massen freilich nicht mehr auf, wie es scheint. Die Partei hat nicht mehr den nötigen Kredit, und eine solche langfristige, zähe Arbeit findet nicht die nötige Unterstützung. Freilich: Die Parteiführung will alles andere als eine solche Arbeit, eine solche Politik. Doch wir haben uns die Frage gestellt, wie die Politik der PAA unter den gegenwärtigen Bedingungen aussehen könnte, wenn sich marxistisch-leninistische Kräfte durchgesetzt hätten. Und unter diesen Bedingungen hätte die PAA, beispielsweise bei den Wahlen, etwa folgendes sagen können:
„Wir sind zu bestimmten Rückschritten bereit, weil die Bedingungen für den Sozialismus derzeit ungünstig sind: z.B. Konzessionen an ausländisches Kapital, aber begrenzt; z.B. freie Märkte für bestimmte Konsumgüter und Dienstleistungen, aber ebenfalls begrenzt. Wir sind bereit, den eigentlichen „Sozialismus“ vorübergehend auf einen bestimmten Sektor der Wirtschaft zu begrenzen, den wir allerdings als den führenden Sektor betrachten, denn wir halten grundsätzlich an der bewussten Planung der Wirtschaft fest, die sich an den gesellschaftlichen Interessen orientiert. In der Landwirtschaft könnten u.U. durchaus erhebliche Rücknahmen im Grad der Vergesellschaftung notwendig sein. Im politischen Leben ist es zu viel Vetternwirtschaft, Bürokratismus usw. gekommen, und hierfür übernimmt unsere Partei, obwohl es auch objektive Faktoren dafür gibt, die Verantwortung. Wir bekämpfen das von nun an nach besten Kräften, sagen aber offen, dass wir das nicht sofort und schon gar nicht vollständig abstellen können. Und wir können hier überhaupt nur Erfolge erzielen, wenn ihr uns unterstützt. Wir sind andererseits bereit, jeden, der sich auf Kosten des Volkes Vorteile verschafft, streng zu bestrafen, besonders streng Mitglieder unserer Partei. Weiter müsst ihr verstehen, dass die schlechte wirtschaftliche Lage besondere Maßnahmen verlangt. Daher müssen auch Arbeiter, die die Gesellschaft betrügen, streng bestraft werden. Betriebsleiter müssen weitgehende Vollmachten erhalten, was nicht unser Ideal ist, aber zur Zeit geht es nicht anders; die Wahl der Betriebsleiter ist zur Zeit nicht möglich. Aber alle politischen Mittel, gegen Bürokratenfilz zu kämpfen, müssen den Arbeitern zur Verfügung stehen; unsere Partei wird die Arbeiter bei diesem Kampf unterstützen und jedes Parteimitglied entfernen, das dies nicht tut. Das ist unser Programm, und dieses Programm wird die Lage nur nach und nach verbessern, und zwar auch nur dann, wenn eine genügend große Zahl von Werktätigen dieses Programm aktiv unterstützt. Die Alternative ist die Errichtung des Kapitalismus, und das bedeutet unter den gegebenen Umständen die Herrschaft des Imperialismus, der Albanien in Not und Elend stürzen wird: Materiell wird es euch auf Dauer wesentlich schlechter gehen, und auch Freiheiten werdet ihr nicht mehr, sondern wesentlich weniger haben, während unser Programm die schrittweise Ausweitung realer Rechte und Freiheiten für die Werktätigen vorsieht. Wir Kommunisten halten daher den Weg, den die Oppositionsparteien vorschlagen, für verderblich, doch wir können und wollen euch unser Programm nicht aufzwingen, denn der Sozialismus kann nur existieren, wenn er die Sympathie des überwiegenden Teils der werktätigen Massen hat. Wenn ihr uns nicht vertraut, dann müsst ihr eben, so leid es uns tut, eure leidvollen Erfahrungen mit Kapitalismus und Imperialismus machen. Entscheidet also selbst.“
Natürlich würde man solche bürgerlichen Parteien nicht zulassen, solange ein einigermaßen festes Band zwischen der Arbeiterklasse und der kommunistischen Partei besteht; die Partei würde dann vielmehr die Klasse gegen die Konterrevolution mobilisieren. Doch wenn die Arbeitermassen kein Vertrauen mehr in die kommunistische Partei haben, würde die gewaltsame Verteidigung der Macht zum Selbstzweck werden und es noch mehr erschweren, das Vertrauen der Klasse wiederzugewinnen. Doch wenn man schon Wahlen durchführt, zu denen man bürgerliche Parteien zulässt, müsste eine kommunistische Partei, die diesen Namen verdient, offen erklären: „Diese Parteien sind Parteien der Konterrevolution, der Herrschaft des Imperialismus über Albanien, sind Parteien eines Weges, der zu Not und Elend führen wird. Unsere Partei wird diesen Weg nicht gehen. Wenn ihr den kapitalistisch-imperialistischen Weg nicht wollt, dann wählt unsere Partei. Wenn ihr das tut, werden wir an unserem Programm arbeiten, und wir erwarten dann eure Unterstützung! Wenn ihr aber den Kapitalismus und die Herrschaft des Imperialismus über Albanien wollt, dann steht unsere Partei für eine solche Politik nicht zur Verfügung.“
Hätte die PAA eine solche prinzipielle Haltung eingenommen, dann hätte sie den Marxismus nicht verraten, dann hätte sie, selbst bei einer Wahlniederlage und dem Verlust der Macht, die Chance gehabt, später das Vertrauen der werktätigen Massen wiederzugewinnen, wenn diese ihre leidvollen Erfahrungen erst gemacht hätten. Die PAA wäre eine marxistisch-leninistische Partei geblieben und hätte keine schlechten Bedingungen gehabt, später wieder um die Macht zu kämpfen. Stattdessen hat die PAA erstens selbst ein Programm der Restauration des Kapitalismus sich zu eigen gemacht und gibt dies zweitens als ein „sozialistisches“ Programm aus. Das zweite ist in jedem Fall Betrug und eine radikale Abkehr vom Marxismus. Das erste (wenn man dabei offen sagt, was man tut) wäre aus der Perspektive des Marxismus-Leninismus richtig, wenn der Kapitalismus aufgrund des Standes der Produktivkräfte objektiv notwendig und fortschrittlich wäre. Dies ist aber nicht der Fall. Erstens hat die Praxis bewiesen, dass der Sozialismus in Albanien möglich ist und riesige Fortschritte gebracht hat. Zweitens ist sicher, dass der Imperialismus – auch ökonomisch – einen riesigen Rückschlag bringen wird. Der Umstand, dass die Masse der Bevölkerung dies nicht so sieht, ändert nichts an diesen Tatsachen. Marxisten aber müssen sich in erster Linie an den Tatsachen orientieren, nicht an der öffentlichen Meinung. Vor allem aber stellt sich die Frage, warum sich in der PAA keine Kräfte durchsetzen konnten, die eine marxistisch-leninistische Politik einschlugen. Warum Revisionisten wie Alia den Kurs der Partei bestimmen, deren einziges Bestreben erkennbar die Sicherung der Macht und der Privilegien einer bestimmten Schicht ist. Offenbar ist der Großteil der leitenden Funktionäre dieser Partei nach und nach den Weg der Verspießerung und schließlich der revisionistischen Entartung gegangen, haben den Klassenstandpunkt des Proletariats und den Marxismus-Leninismus zunehmend nur noch im Munde geführt, als Religion behandelt, wobei es völlig gleichgültig ist, ob und wie lange sie an diese Religion noch geglaubt haben. Ihr Handeln war zunehmend von ihrem eigenen Klasseninteresse, dem einer verspießernden, verbürokratisierenden Schicht, die sich immer mehr Privilegien sicherte, geprägt. Dem entsprach, dass auf dem anderen Pol der Gesellschaft das Proletariat immer mehr sein Klassenbewusstsein einbüßte, weil die PAA zunehmend ihren Charakter als proletarische Vorhutpartei einbüßte und die Arbeiter ohne Führung ließ.
Nach all unseren Erfahrungen kann der Prozess nur so abgelaufen sein, und es gilt, dies so genau wie möglich nachzuzeichnen, auch wenn uns viele Fakten fehlen. Doch kommt uns hier unsere Kenntnis der Entwicklung der DDR zugute: Wie schon gesagt, können wir hier beträchtliche Parallelen feststellen. Und unsere Kenntnisse über die Entwicklung in Albanien müssten systematisiert werden. Es spricht beispielsweise durchaus Bände, wenn vor zwei Jahren Funktionäre des Jugendverbandes auf die Frage von Genossen unserer Reisegruppe, wie sie denn den bürgerlichen Einfluss in der Jugend bekämpfen würden, antworteten, einen solchen Einfluss gebe es nicht, die Jugend stünde geschlossen hinter der Partei. Wie konnte die Partei solche Funktionäre hervorbringen? Wie konnte die Partei Verhältnisse zulassen, unter denen es offenbar für Funktionäre vorteilhaft war, sich so zu verhalten? (Wobei es ganz egal ist, ob diese Funktionäre das glaubten!) Da muss doch schon ein Klima geherrscht haben, in dem man mehr oder weniger bewusst davon ausging, der Vormarsch der bürgerlichen Ideologie sei ohnehin unaufhaltsam, also müsse man wenigstens die Fassade aufrechterhalten, damit es keinen Erdrutsch gibt. Das aber bedeutet, dass sich ein großer Teil der Parteikader objektiv nicht mehr von proletarischen Klasseninteressen leiten ließ. Und hier liegt bereits der Keim des Revisionismus in der Partei.
.
Unsere Haltung zu Albanien in der Vergangenheit
Im „Roten Morgen“ 7 und 8/1990 begrüßten wir die sogenannten Reformen in Albanien. Bereits Ende 1989 druckten wir die Rede von Ramiz Alia vom 8. Plenum des ZK der PAA nach und brachten zum Ausdruck, dass wir diese Rede positiv einschätzten. Heute wissen wir, dass die „Reformen“ den Übergang zum Revisionismus und Kapitalismus bedeuteten. Somit stellt sich die Frage, wie es dazu kam, dass wir diese „Reformen“ begrüßten.
Wir haben insbesondere verschiedene Maßnahmen der Dezentralisierung von Planungs- und Leitungskompetenzen positiv eingeschätzt. Wir nahmen an, dass dies Mittel wären, um die Initiative der Werktätigen zu steigern, die sozialistische Demokratie zu verbessern und mehr mit Leben zu erfüllen.
Die albanischen Stellungnahmen, insbesondere die von Ramiz Alia, versuchten, diese Maßnahmen in einem positiven Licht erscheinen zu lassen. Die wirtschaftlichen Maßnahmen waren mit verschiedenen politischen Maßnahmen verbunden: So sollten mehr Leiter von Betrieben und Einrichtungen des Staatsapparats gewählt werden, es sollte die Wahl zwischen mehreren Kandidaten möglich sein, und es sollte (so die Darstellung Alias) offener diskutiert werden, indem die falsche Vorstellung beseitigt wurde, alle Beschlüsse müssten einstimmig erfolgen. Alia erklärte demagogisch, die Einheit in den Prinzipien werde nicht angetastet, sondern im Gegenteil besser verwirklicht, wenn über einzelne Fragen, die die Prinzipien nicht betreffen würden, kontrovers diskutiert und abgestimmt werde.
All dies klang gut, es klang so, als sei dies ein Kampf gegen den Bürokratismus, gegen den Kommandogeist, der die Massen einem formalen Reglement unterwirft und ihre Initiative hemmt, ein Kampf für die Hebung der Aktivität der Massen beim Aufbau des Sozialismus. Und wir sind nach wie vor der Meinung, dass der Sozialismus einen solchen Weg gehen muss, wenn er sich behaupten will.
Es gibt sicherlich Situationen, in denen die führende Rolle der Partei in sehr schroffer Form zum Ausdruck kommen muss, in denen man sich bei der Ausübung der Diktatur des Proletariats unmittelbar nur auf einen relativ kleinen Teil der Klasse stützen kann, in denen die Initiative der breiten Massen relativ wenig entwickelt ist und die Apparate des Staates folglich eine sehr große Rolle spielen müssen. Doch man muss verstehen, dass dies alles andere als ein erwünschter Zustand ist, dass es sich hier vielmehr um Krücken handelt.
So kritisierte Lenin 1920/21 im Kampf gegen die sogenannte Arbeiteropposition um Bucharin, Schljapnikow und Kollontai sehr scharf die Losung dieser Fraktion, die werktätigen Massen müssten sofort die Leitung der gesamten Volkswirtschaft in die Hand nehmen. Er wies nach, dass dies illusorisch war, dass die Bedingungen dafür nicht vorhanden waren, sondern erst geschaffen werden mussten. Gleichzeitig aber hielt er entschieden an der Zielvorstellung fest, dass die werktätigen Massen die Leitung der gesamten Volkswirtschaft in die Hand nehmen sollten. Er kritisierte die „Arbeiteropposition“ gerade deshalb, weil sie die „Leitung der Volkswirtschaft durch die werktätigen Massen selbst“ lediglich als Phrase im Munde führte, aber die erforderliche langwierige Arbeit zur Verwirklichung dieses Ziels nicht leisten wollte: „Der Syndikalismus überträgt die Leitung der Industriezweige (Haupt- und Zentralverwaltungen) der Masse der parteilosen, nach Produktionsbereichen gegliederten Arbeiter; er hebt dadurch die Notwendigkeit der Partei auf und leistet keine langwierige Arbeit, um die Massen zu erziehen und die Leitung der gesamten Volkswirtschaft tatsächlich in ihren Händen zu konzentrieren.“ (Lenin, Die Krise der Partei, Werke Band 32, Seite 34)
Mit anderen Worten: Lenin kritisierte die syndikalistische Abweichung gerade deshalb, weil ihre Politik nicht darauf ausgerichtet war, das Ziel zu verwirklichen, das sie lauthals im Munde führte, nämlich die Leitung der gesamten Volkswirtschaft in den Händen der werktätigen Massen zu konzentrieren.
Die liberale, anarchosyndikalistische Abweichung ist lediglich eine Variante des Revisionismus, die die Diktatur des Proletariats zu Fall bringen kann. Die andere Variante besteht darin, das Ziel der Leitung durch die werktätigen Massen mehr oder weniger offen aufzugeben und die Leitung durch Apparate, durch besondere Spezialisten, durch Partei und Staat zu verewigen!
Das ist deshalb revisionistisch, weil damit die Orientierung der sozialistischen Gesellschaft auf den Kommunismus beseitigt wird. Eine solche Konzeption mag sehr viel von der führenden Rolle der Partei reden, aber das ist demagogisch, denn wenn das Ziel der Arbeit der Partei nicht mehr darin besteht, die Masse der Arbeiter zur unmittelbaren Leitung zu befähigen, dann ist die Partei keine Vorhutpartei der Arbeiterklasse mehr.
Eine solche revisionistische Orientierung wird ganz offen zum Programm erhoben, wenn die PAA in ihrem Wahlprogramm erklärt, ihr grundlegendes Ziel sei „die Sorge für den Menschen, seinen Wohlstand, die Schaffung notwendiger Bedingungen, um die materiellen und geistigen Bedürfnisse des Volkes zu befriedigen.“
Also: Die Partei „sorgt für den Menschen“, anstatt die Selbsttätigkeit der Gesellschaftsglieder anzustreben, anstatt anzustreben, dass die Arbeiter – und zwar auch die parteilosen Arbeiter – Schritt für Schritt ihre Rolle als regierende Klasse real einnehmen. Das läuft der Leninschen Forderung diametral entgegen:
Der Kommunismus sagt: Die Avantgarde des Proletariats, die Kommunistische Partei, führt die parteilose Masse der Arbeitenden, indem sie diese Masse, zuerst die Arbeiter und dann auch die Bauern, aufklärt, sie schult, bildet und erzieht (Schule des Kommunismus), damit sie dahin gelangen können und wirklich gelangen, die Leitung der gesamten Volkswirtschaft in ihren Händen zu konzentrieren. (ebenda)
Die Vorstellung von der Partei, die „für die Massen sorgt“, erinnert stattdessen an den Ausspruch des polnischen Revisionisten Gierek: „Wir werden gut regieren, und ihr werdet gut arbeiten.“
Ein solches offenes Zugeständnis der völligen Abkehr vom Kommunismus ist freilich erst der Endpunkt einer längeren revisionistischen und damit konterrevolutionären Entwicklung. Und wir hatten, wie gesagt, die Hoffnung, dass die von Alia verkündeten Reformen gerade einer solchen Entwicklung entgegenwirken könnten, indem sie die Selbsttätigkeit der Werktätigen forderten. Wir hofften auch, dass die Ausweitung der materiellen Anreize nicht in erster Linie den Individualismus und einen engen „privaten Horizont“ fördern sollte, sondern dass sie darauf berechnet war, die Werktätigen anhand ihrer praktischen Erfahrung fühlen zu lassen, dass sie selbst ihr Schicksal und ihr Wohlergehen in der Hand hatten, dass diese Maßnahmen also organischer Bestandteil einer Gesamtkonzeption waren, die die Initiative der Massen und damit den Keim des Kommunismus in der sozialistischen Gesellschaft fördern sollte. Diese unsere Hoffnungen hatten mit der Realität nichts zu tun, doch aufgrund unserer sehr begrenzten Kenntnisse über die Lage in Albanien wussten wir das zu diesem Zeitpunkt nicht. Wir hatten nicht die geringste Vorstellung davon, welches Ausmaß die Kluft zwischen Partei und Klasse bereits angenommen hatte, in welch hohem Maße sich eine privilegierte Schicht herangebildet hatte, deren Ziel vor allem die Verteidigung ihrer Macht und ihrer Privilegien war, und dass als logische Folge davon die kommunistische Initiative der Massen fast völlig beseitigt war. Unter diesen Umständen aber konnten die Reformen, wie wir heute wissen, nicht auf die Festigung des Sozialismus hinauslaufen, sondern nur auf die offene Konterrevolution. Sie waren Ausdruck der Tatsache, dass die wirtschaftliche Zerrüttung ein solches Maß erreicht hatte, dass die herrschende Funktionärsschicht nicht mehr mit den alten Methoden herrschen konnte, dass das System eines hochentwickelten, zunehmend bürokratischen Zentralismus bei rapide abnehmender Initiative der Massen sich überholt hatte. Die Dezentralisierung hatte somit nicht den Inhalt, die lokale Initiative der Massen als gesellschaftliche Initiative zu fordern, sondern das individuelle Denken nur für sich selbst zu stärken und die Zersplitterung in konkurrierende Warenproduzenten herbeizuführen. Das war diesen Maßnahmen selbst nicht anzusehen, sondern man musste die konkreten Klassenverhältnisse kennen, um zu wissen, dass die Maßnahmen diesen reaktionären Inhalt hatten und nicht den von uns erhofften positiven. Es ist eben so, dass ein und dieselbe Maßnahme unter bestimmten Bedingungen die sozialistische Demokratie, die Initiative der Massen fördern kann, unter anderen Bedingungen aber die Konterrevolution.
Wir waren uns im Übrigen durchaus dessen bewusst, dass die Reformen in Albanien auch Gefahren beinhalten konnten, und haben dies intern auch so diskutiert. Ein zu diesem Zeitpunkt vermeidbarer Fehler bestand lediglich darin, dass wir dies nicht auch öffentlich so gesagt haben, dass wir im „Roten Morgen“ stattdessen eine Deutungsmöglichkeit der Reformen unumwunden als Wirklichkeit, als objektive Realität, dargestellt haben.
Weitaus schwerwiegender ist jedoch ein anderer Fehler, der nicht nur unsere Haltung im letzten Jahr oder in den beiden letzten Jahren betrifft, sondern unsere Haltung seit der Gründung unserer Partei. Dieser Fehler besteht darin, dass wir dazu neigten, die Entwicklung eines sozialistischen Landes – und eben auch des sozialistischen Albanien – nicht als einen schwierigen, komplexen, widersprüchlichen Prozess zu betrachten, dass es folglich eine Tendenz gab, konkrete Erscheinungen in Albanien zu idealisieren, zu verklären, zu verherrlichen. Gewiss haben wir in allgemeiner Form immer davon gesprochen, dass es im Sozialismus natürlich auch Widersprüche, und zwar eben auch antagonistische Widersprüche, gibt. Doch konkret haben wir uns oft nicht so verhalten, haben Erscheinungen in Albanien verteidigt, ohne sie zu verstehen, ohne sie aus den Umständen, den objektiven und subjektiven Bedingungen, aus dem Kräfteverhältnis der Klassen heraus zu begreifen. Teilweise beruhte dies auf unserem mangelnden theoretischen Verständnis der Gesetzmäßigkeiten des Sozialismus, der Übergangsgesellschaft zwischen Kapitalismus und Kommunismus, und wir unternehmen jetzt Anstrengungen, um die theoretischen Lücken nach und nach zu schließen. Doch dies allein ist noch keine vollständige Erklärung unserer Fehler in dieser Frage wie auch in anderen Fragen, die die Klassenrealität in unserem eigenen Land betreffen. Denn es stellt sich sofort die Frage, warum wir nicht schon früher Anstrengungen unternommen haben, um diese theoretischen Lücken zu schließen, warum wir diese theoretischen Lücken früher gar nicht als solche erkannt haben? Unserer Meinung nach liegt dem ein mangelndes, fehlerhaftes Verständnis des Marxismus-Leninismus als der revolutionären Weltanschauung und Methode zur Erkenntnis und Umgestaltung der Welt zugrunde. Lenin hob hervor, dass „der Marxismus kein totes Dogma, nicht irgendeine abgeschlossene, fertige, unveränderliche Lehre, sondern eine lebendige Anleitung zum Handeln ist“. (Lenin, Werke Band 17, Seite 27)
Doch wir hatten eine Tendenz, ihn als fertige, abgeschlossene Lehre zu betrachten und zu behandeln, die es nur „anzuwenden“ galt. So trennten wir beispielsweise die Begriffe der „Anwendung“ und der „Weiterentwicklung“ des Marxismus-Leninismus willkürlich und meinten, wir könnten uns damit begnügen, ihn „anzuwenden“.
Doch das Leben wirft ständig neue Probleme auf, und Marxisten-Leninisten haben die Pflicht, den Marxismus-Leninismus in der Analyse dieser Probleme fortzuentwickeln. Dies entspricht genau der Methode von Marx. Lenin hob hervor, „dass der Marxismus nichts enthält, was einem ‚Sektierertum‘ im Sinne irgendeiner abgekapselten, verknöcherten Lehre ähnlich wäre, die abseits von der Heerstraße der Entwicklung der Weltzivilisation entstanden ist. Im Gegenteil: die ganze Genialität Marx‘ besteht gerade darin, daß er auf die Fragen Antworten gegeben hat, die das fortschrittliche Denken der Menschheit bereits gestellt hatte.“ (Lenin, Werke Band 19, Seite 3)
Stellen sich der Menschheit neue Probleme, so müssen Marxisten hierauf neue Antworten geben, und zwar auf der Grundlage und mit Hilfe der bewährten Weltanschauung und Methode des Marxismus-Leninismus. Beispielsweise ist Stalins Schrift über die ökonomischen Probleme des Sozialismus in der UdSSR zweifellos eine bedeutende Fortentwicklung der marxistisch-leninistischen Theorie der Übergangsgesellschaft, doch naturgemäß konnte sie die Probleme der Übergangsgesellschaft nicht abschließend klären. Insbesondere die Erfahrung, die die Menschheit mit dem Revisionismus gemacht hat, wirft eine ganze Reihe von Fragen auf, die sich auch auf den Sozialismus beziehen, aus dem der Revisionismus ja hervorgegangen ist, Fragen, die Stalin naturgemäß nicht beantworten konnte, die wir aber zu beantworten verpflichtet sind. Kommt man dieser Pflicht jedoch nicht nach, bleibt man mehr oder minder in der Vorstellung befangen, man könne den Marxismus-Leninismus in einer „fertigen“ Form „verteidigen und anwenden“, so führt dies zu einer Verkümmerung, Verknöcherung und zu einer Stagnation des marxistischen Denkens. Es besteht dann die Gefahr, dass man den Marxismus-Leninismus zu einem Dogmensystem verkommt, in das man die Wirklichkeit gewaltsam hineinpresst.
Natürlich haben wir dies nicht ausschließlich getan, doch es bestanden Tendenzen in dieser Richtung, und zwar gerade auch in der Betrachtung des sozialistischen Albanien. In der Zeit des Sektierertums waren diese Tendenzen sehr stark und oft genug vorherrschend. Hielt sich beispielsweise eine Reisegruppe der KPD in Albanien auf, so wurde meist alles und jedes, was man erlebte, für richtungsweisend und revolutionär erklärt und in absoluter Form verteidigt, und es wurde Druck auf diejenigen ausgeübt, die eine solche metaphysische Betrachtungsweise nicht teilen wollten. Derartige Erscheinungen haben die Rechten und Trotzkisten, die zuvor oft selbst die schlimmsten Sektierer waren, in der Partei später genutzt, um das sozialistische Albanien zu verleumden. Aufgrund dieser Erfahrungen haben wir nach unserem offenen Bruch mit den Koch-Trotzkisten unsere Haltung in solchen Fragen korrigiert, haben dies aber nicht in jeder Hinsicht konsequent getan. Auch in den letzten Jahren kam es vor, dass Erscheinungen in Albanien um jeden Preis verteidigt wurden, ob wir sie begriffen haben oder nicht. Natürlich spielte der antikommunistische ideologische Druck, den der Imperialismus auf uns ausübte, dabei eine Rolle und drängte uns mitunter in eine Verteidigerrolle, ohne dass wir die Dinge, die wir verteidigten, immer durchdacht und begriffen hatten. Doch in eine solche Rolle darf man sich nicht drängen lassen, denn dann isoliert man sich von fortschrittlichen Menschen, die mit Recht bestimmte Fragen stellen und es sehr wohl spüren, wenn wir als Kommunisten solche Fragen nicht ernst nehmen, wenn wir Tatsachen, die nicht in unsere Vorstellung von den Dingen passen, nicht wahrhaben wollen.
Letzteres aber sollte einem Marxisten gar nicht unterlaufen: Passen Tatsachen nicht in die Theorie, die man hat, so darf man nicht die Tatsachen leugnen oder zurechtbiegen, sondern man muss seine Theorie überprüfen. Das bedeutet keineswegs, den Marxismus-Leninismus zu „überprüfen“ und zur Disposition zu stellen. Doch unsere Auffassung, unser Verständnis des Marxismus-Leninismus kann in diesen oder jenen Fragen sehr wohl unrichtig oder unvollständig sein und muss dann korrigiert bzw. weiterentwickelt werden. Was unsere Haltung zu Albanien betrifft, so werden wir stets einen entscheidenden und grundlegenden Trennstrich ziehen zwischen dem revolutionären, dem sozialistischen Albanien Enver Hoxhas einerseits und dem heutigen revisionistischen Albanien, das in den offenen Kapitalismus übergehen wird, andererseits. An dieser Trennungslinie werden wir auch nichts relativieren; es handelt sich um die Trennungslinie zwischen Revolution und Konterrevolution. Gleichzeitig aber werden wir die komplexe und widersprüchliche Wirklichkeit der sozialistischen Gesellschaft, darunter eben auch des sozialistischen Albanien, genauer untersuchen. Und zwar gerade auch deshalb, um bessere und genauere Antworten auf die Frage geben zu können, wie die revisionistische Entartung verhindert, wie das Voranschreiten der Gesellschaft zum Kommunismus gewährleistet werden kann. Und schließlich werden wir uns bemühen, der Verknöcherung, der Stagnation des Denkens auch in anderen Bereichen, in denen dies bei uns aufgetreten ist, entgegenzuwirken. Wir werden uns darum bemühen, den Marxismus-Leninismus besser als schöpferische Weltanschauung und Methode zur Erkenntnis und zur Umgestaltung der Welt zu nutzen.
.
Generalstreik der Arbeiter fegt PAA-Regierung weg
Die Alleinregierung der PAA unter Ministerpräsident Fatos Nano musste nach nur 26 Tagen Amtszeit zurücktreten. Dies war durch einen Generalstreik der Arbeiter erzwungen worden. Sie wurde durch eine Regierung unter Beteiligung der bürgerlichen Parteien abgelöst. Sämtliche Mitglieder der neuen Regierung müssen ihre Parteimitgliedschaft für die Dauer ihres Amtes ruhen lassen. Diese Maskerade wurde von den neuen Koalitionspartnern der PAA durchgesetzt.
Die PAA, die auf dem 10. Parteitag in Sozialistische Partei umbenannt wurde, sollte dadurch dazu genötigt werden, in aller Form symbolisch zu erklären, dass sie sich von jeglichem Gedanken an die führende Rolle einer Partei der Arbeiterklasse und damit von jeglichem Gedanken an den Aufbau des Sozialismus ein für alle Mal verabschiedet hat. Faktisch aber hatte die PAA diesen Abschied schon früher vollzogen. Eine Partei der Arbeiterklasse, die diesen Namen verdient, darf in einem Arbeiterstaat keineswegs darauf hinarbeiten, möglichst viele Positionen für sich zu reservieren, sondern ihr Ziel muss es sein, möglichst viele, auch parteilose, Arbeiter dazu zu befähigen, leitende Positionen in Staat, Wirtschaft und überhaupt allen Bereichen der Gesellschaft einzunehmen. Die PAA unter Führung Enver Hoxhas hatte diese revolutionäre Orientierung, doch offensichtlich ist diese Orientierung immer schwächer geworden und schließlich ganz verlorengegangen. Wir werden uns in Zukunft bemühen, diesen Prozess, seine objektiven und subjektiven Bedingungen, so genau wie möglich zu untersuchen. Was aber bereits jetzt klar auf der Hand liegt, was ohne komplizierte Analyse, sozusagen durch bloße Beobachtung festgestellt werden kann, ist das Endstadium dieses Prozesses: Die PAA ist objektiv keine Partei der Arbeiterklasse mehr, vertritt objektiv nicht mehr deren Interessen. Das ist jetzt offenkundig, denn wie sonst sollte es zu erklären sein, dass die PAA zwar 56 % der Stimmen erhielt, aber kaum Stimmen von Arbeitern?
Dass die PAA-Alleinregierung durch einen Generalstreik der Arbeiter hinweggefegt wurde? Wenn wir jedoch feststellen, dass die PAA ihren Charakter als Arbeiterpartei eingebüßt hat, so ist dies nicht erst das Ergebnis der kapitalistischen „Reformen“, sondern war bereits ihr Ausgangspunkt. Denn eine Gesellschaft, die in relativ hohem Ausmaß auf die Triebkräfte und Steuerungsmittel des Marktes verzichtet, kann auf Dauer nur existieren, wenn sie Triebkräfte entwickelt, die einer höheren Ordnung angehören. Diese Triebkräfte liegen in der Selbsttätigkeit der Gesellschaftsmitglieder, in der aktiven Teilnahme der Arbeitenden an der Planung, Leitung und Kontrolle der Produktion auf Grundlage ihres eigenen Interesses. Die Entwicklung dieser Selbsttätigkeit wird jedoch stets auf Schranken stoßen, solange noch Klassen existieren, insbesondere solange eine Arbeitsteilung zwischen Kopf- und Handarbeit besteht und Spezialisten für Kopfarbeit sowie leitende Tätigkeiten existieren. Deshalb kann sich die Übergangsgesellschaft des Sozialismus nicht allein auf diese Selbsttätigkeit stützen, sondern benötigt auch die Leitung durch staatliche Apparate und die Kommunistische Partei. Wenn es jedoch dazu kommt, dass Staat und Partei vorwiegend die Interessen der Schicht von Spezialisten vertreten, wird die Spaltung der Gesellschaft in Klassen verfestigt, anstatt auf deren Aufhebung hinzuarbeiten; die Selbsttätigkeit der Gesellschaftsmitglieder als Triebkraft der Produktion geht nach und nach verloren. Kommt dies einerseits vor und werden andererseits die Triebkräfte und Steuerungsmittel des Marktes – letztlich also der Kapitalismus – nicht wiederhergestellt, so führt dies auf Dauer zu noch verheerenderen Wirtschaftskrisen als im Kapitalismus: Nicht Überproduktionskrisen, sondern ein Rückgang der Produktion aufgrund mangelnden Interesses der Produzenten drücken den Konsum der Massen auf ein Minimum. Die Wiederherstellung des Kapitalismus, objektiv ein Rückschritt, erscheint unter diesen Umständen subjektiv als ein „Ausweg“ aus der Lage.
.
Die Wirtschaftsreformen Alia und Carcanis
Vor einem Jahr noch waren Alia, Carcani und andere revisionistische Führer der PAA bestrebt, diesen Weg sozusagen in einer dosierten, gemäßigten Form zu beschreiten. So stellte Adil Carcani im Mai 1990 auf der 11. Legislaturperiode der Volksversammlung ein ökonomisches Konzept vor, dessen Grundzüge man schematisch in etwa wie folgt kennzeichnen kann: Die Kompetenzen der Betriebe und somit faktisch der Betriebsleiter sollten beträchtlich ausgeweitet werden; in bestimmten Fällen (Betriebe, die Massenbedarfsartikel produzieren) sollten die Betriebe „den gesamten Produktionsplan vollkommen selbst festlegen“ (Albanien heute 3/1990, S. 10). In diesen Fällen war also die zentrale Planung bereits vollständig beseitigt, in anderen Fällen „lediglich“ erheblich eingeschränkt, aber eben nicht vollständig. Betriebe, die als besonders wichtig eingeschätzt wurden, sollten nach wie vor Materialzuteilungen in Naturalien erhalten (S. 10), anstatt sich die erforderlichen Produktionsmittel und Rohstoffe auf dem Markt zu besorgen. Auch bei den anderen Betrieben sollten die Exekutivorgane der örtlichen Volksräte, also Organe der Staatsmacht, Mitspracherechte bei der Verteilung der Produkte erhalten, die Verteilung sollte also nicht allein dem Markt überlassen bleiben.
Was war der klassenmäßige Inhalt dieser Maßnahmen? Da die Parteiführung jeden Gedanken an die Hebung der Rolle der Arbeitenden bei der Leitung von Produktion und Verteilung aufgegeben hatte, setzte sie konsequenterweise „auf den Markt“ und verlieh daher den Betriebsleitern zunehmend die Rolle von selbstständigen Warenproduzenten. Sie versuchte jedoch, dabei nicht zu weit zu gehen, die Kompetenzen der staatlichen Organe nicht allzu sehr zu beschneiden, um diese Organe nicht überflüssig zu machen. Früher hatten diese Organe als Machtorgane des proletarischen Staates die Wirtschaft im Interesse der Arbeitenden geleitet; mit der zunehmenden Abkehr von der Orientierung auf die Heranziehung der Arbeitenden zur Leitungstätigkeit, mit der zunehmenden Öffnung der klassenmäßigen Kluft in der Gesellschaft, hatten diese Staatsorgane jedoch zunehmend die Interessen der privilegierten Schicht vertreten.
Diese Schicht war freilich nicht einheitlich: Auf der einen Seite gab es die Betriebsleiter, deren Freiheit, als selbstständige Warenproduzenten zu fungieren, von den staatlichen Organen beschränkt wurde. Auf der anderen Seite gab es die Bürokraten in den staatlichen Organen, deren Tätigkeit sich zwar immer weniger an den Interessen der Arbeitenden orientierte, die aber die Aufrechterhaltung der alten sozialistischen Formen zur Verteidigung ihrer Pfründe benötigten und die daher sehr viel weniger als die Betriebsleiter an ökonomischen Reformen im kapitalistischen Sinne interessiert waren. Freilich waren die Widersprüche zwischen diesen beiden Teilen der privilegierten Schicht relativ: Sie brauchten sich gegenseitig. Sie mussten sich insbesondere miteinander arrangieren, wenn sie die Herrschaft der bestehenden privilegierten Schicht in der alten politischen Form aufrechterhalten wollten: in der Form einer Ein-Parteien-Regierung der PAA, die vorgab, eine Regierung der Diktatur des Proletariats zu sein. Alia und Carcani waren daher gerade auch als Vertreter des Parteiapparats daran interessiert, die Interessen der beiden Teile der herrschenden Schicht miteinander zu kombinieren und keine Neuerungen in Gang zu setzen, die das System als Ganzes gefährden könnten.
Auf dem 10. Plenum des ZK der PAA im April 1990 erklärte Alia im Zusammenhang mit den Veränderungen im Bereich der Landwirtschaft: „Aber wie auch immer entschieden wird, die Parteikomitees, die Exekutivkomitees (der staatlichen Machtorgane, RM) und die Vorstände der landwirtschaftlichen Genossenschaften sollten nicht glauben, sie seien nun von der Arbeit entlastet, ‚befreit‘ von dem Kreuzproblem der Versorgung der Bevölkerung mit Viehzuchtprodukten. Nein, ganz im Gegenteil, sie haben nun eine gewaltige Organisations- und Erziehungsarbeit zu leisten, damit die Produktion sowohl für die Bauernschaft wie auch für die Stadt effektiv zunimmt. Den staatlichen Organen erwachsen eine Menge Aufgaben, insbesondere hinsichtlich der Festlegung von Regeln und Normen für den Bauernmarkt und der Verpflichtungen gegenüber dem Staat.“
Im Nachhinein ist es unschwer zu erkennen, dass Alia dem bürokratischen Teil der privilegierten Schicht damit zurufen wollte: „Sperrt euch nicht gegen die Reformen! Die Partei wird dafür sorgen, dass euch nicht alle Kompetenzen weggenommen werden, dass ihr eure gesellschaftliche Stellung im Großen und Ganzen behaltet, wenn auch in veränderter Form.“ Dies galt natürlich nicht nur für die Landwirtschaft. Ebenfalls auf dem 10. Plenum sagte Alia: „Einige Büromenschen, die daran gewöhnt sind, sich der Rechte anderer zu bedienen und sich mit einsamen Befehlen und Beschlüssen ihre Autorität zu erhalten, fragen nun: ‚Aber mit was sollen wir uns dann befassen?‘ Diese Genossen vergessen, dass die zentralen Organe oder die Exekutivkomitees nicht dazu da sind, Fonds und die materielle Basis aufzuteilen, sondern dazu, sich ernsthaft und kompetent mit der Erarbeitung einer Politik der Entwicklung auf dem betreffenden Gebiet zu befassen, mit Strategien des technischen und technologischen Fortschritts, mit sinnvollen allgemeinen Untersuchungen, die sich auf die Praxis, auf den Kontakt zu ihren Betrieben und Systemen, auf ihre Kontrolle stützen. Unter den gegebenen Bedingungen ist es möglich, auf wissenschaftlicher Grundlage die Aufgaben und Funktionen in der gesamten Pyramide des Leitungsapparats neu aufzuteilen.“ Das war zwar eine deutliche Kritik an den Bürokraten der Zentralmacht wie auch der örtlichen Staatsorgane, die sich den Reformen widersetzten, aber die Kritik war verbunden mit der Hoffnung, dass es gelingen werde, ein revisionistisches Staats- und Wirtschaftssystem zu errichten, in das diese Teile der privilegierten Schicht integriert werden konnten.
Carcani behauptete bei seiner Begründung des ökonomischen Reformprogrammes sogar, trotz steigender Kompetenzen der Betriebsleiter werde sich zugleich auch die Bedeutung der Organe der staatlichen Zentralmacht erhöhen: „Inzwischen gewinnen die Präsenz, die Kontrolle und die Rolle des Staatshaushaltes, aller Finanzorgane in den Ministerien und in den anderen zentralen Institutionen sowie im Finanzministerium selbst einen qualitativ neuen Inhalt bei der erweiterten Reproduktion der Betriebe auf eigene Rechnung. Sie werden wie bisher auf die Verfolgung und die Kontrolle über die Effektivität der Leistung der Ausgaben nicht verzichten, im Gegenteil, ihre Rolle und Verantwortung werden sich erhöhen. Durch tiefgreifende Studien und Analysen werden sie dabei helfen, die primäre Reihenfolge der Entwicklung einzelner Branchen und Sektoren der Wirtschaft zu bestimmen.“ (Albanien heute 3/1990, S.16)
Gewiss: Vom Standpunkt des Marxismus aus ist die Vorstellung absurd, man könne einerseits den Betriebsleitern in relativ hohem Maße die Stellung freier Warenproduzenten einräumen, andererseits durch staatliche Reglementierung eine planmäßige und proportionale Entwicklung der verschiedenen Zweige der Volkswirtschaft garantieren. Sind „kommunistische“ Parteiführer aber erst einmal untrennbar mit einer privilegierten Schicht verbunden, die sich anschickt, zur neuen Ausbeuterklasse zu werden, so „vergessen“ sie ihr marxistisches Wissen rasch, denn ihr Klassenstandpunkt, ihre Klasseninteressen sind dann mit dem Marxismus unvereinbar.
.
Die Revisionisten treten noch gegen Parteienpluralismus auf
Wie gesagt: Die Führer der PAA mussten versuchen, die Interessen beider Teile der privilegierten Schicht zu verteidigen, wenn sie die beherrschende Stellung der PAA erhalten wollten. Und zu diesem Zeitpunkt hofften sie noch, dass dies möglich sein würde. Alia selbst erklärte mehrmals, es gebe keine Grundlage für andere Parteien als die PAA, und er betonte dies auch noch in seinem Schlusswort auf dem 11. Plenum am 6. Juli 1990: „Niemand, keine andere Kraft in unserem Land, keine Einmischung von außen kann die wahre Demokratie, die Rechte des Volkes, den Fortschritt des Landes gewährleisten und die Freiheit und Unabhängigkeit des Landes verteidigen. Das kann nur die Partei und das um sie vereinte Volk leisten.“ Nexhmije Hoxha erklärte im Juni 1990 vor dem Generalrat der Demokratischen Front sogar, andere Parteien seien „künstliche Parteien, die niemanden vertreten“ (Albanien heute 3/90, S. 7). In diesem Zusammenhang lobte sie „die gesunde moralisch-politische Lage und die Sicherheit der inneren Einheit“ (ebenda).
Hier zeigt sich sehr drastisch, in welchem Maße die Führer der PAA zu diesem Zeitpunkt bereits die Wirklichkeit leugneten und nur noch eine Scheinwelt gelten ließen, die ihren subjektiven Wünschen und Interessen entsprach. Diese Wünsche und Interessen waren jedoch nicht der Sozialismus oder eine wirkliche Arbeitermacht, sondern die Monopolisierung aller Entscheidungskompetenzen in ihren Händen. Die bereits in den letzten beiden Ausgaben von Roter Morgen angegriffene typische Phrase der Revisionisten von der „Fürsorge für die Menschen“ findet sich in der Rede von Nexhmije Hoxha vor dem Generalrat der Demokratischen Front sogar in der Form einer Definition des „Kerns des Sozialismus“:
„Die Fürsorge für die Menschen, für ihre Rechte, bildet den Kern des Sozialismus.“ (ebenda, S. 6) Statt Selbsttätigkeit also Fürsorge; das war der Wunschtraum, auf ewig in der alten Form weiterherrschen zu können. Als „Fürsorge“ erklärte die Macht der Parteiführer im Interesse einer privilegierten Schicht statt der Diktatur des Proletariats mit dem Ziel der Aufhebung der Klassen. Sowohl diese revisionistische Auslegung der führenden Rolle der Partei als auch die ökonomischen Reformen mit teilweiser Beseitigung der Planwirtschaft wurden jedoch als marxistisch-leninistisch ausgegeben, und besonders Alia scheute sich nicht, die Reformen als ein Voranschreiten des Sozialismus darzustellen.
.
„Vervollkommnung der Gesellschaft“
Auf dem 10. Plenum im April 1990 sprach er von der „ununterbrochenen Vervollkommnung unserer Gesellschaft“. „Die werktätigen Massen beweisen Kultur, Reife und eine ausgewogene Urteilsfähigkeit… Die Fähigkeit der Massen, mit den demokratischen Mitteln, Gesetzen und Institutionen im Dienst des sozialistischen Fortschritts umzugehen, spricht für die Richtigkeit der Parteibeschlüsse. Wäre es umgekehrt zu Missbrauch gekommen, hätten wir Anlass, uns gründlich den Kopf zu zerbrechen.“ Die Lage war also angeblich so stabil, dass man dem Kopf eine Ruhepause gönnen konnte. Ja, der Sozialismus war Alia zufolge in Albanien zu diesem Zeitpunkt stabiler als je, strotzte geradezu vor Lebenskraft; das Volk hat die Beschlüsse dieses Plenums (des 9. RM) positiv aufgenommen und sich zu Taten inspirieren lassen, die der ununterbrochenen Vervollkommnung unserer Gesellschaft dienen.“ (10. Plenum) „In den drei Monaten seit dem 9. Plenum hat unser Land eine neue Phase des revolutionären Aufbruchs durchgemacht.“ (ebenda)
„Der Kampf für die Demokratisierung des Lebens im Land ist ein historischer Prozess, der den Sozialismus bei jedem Schritt begleiten muss. Die aktuellen Maßnahmen stellen in Wahrheit einen zweiten Zyklus, eine neue Phase der historischen Periode dar, die an der Schwelle zu den siebziger Jahren eingeleitet wurde, mit den bekannten Reden des Genossen Enver Hoxha und den Beschlüssen, die die Partei damals zur allgemeinen Revolutionierung ihres eigenen Lebens und des Lebens im ganzen Land fasste.“ (ebenda)
„Die Veränderungen auf dem Feld der Produktionsverhältnisse, die von der Partei angeregt wurden und die auf dieser Tagung des Plenums des Zentralkomitees legitimiert werden sollen, stellen einen wertvollen Beitrag zur sozialistischen Wirtschaftswissenschaft dar… Man kann getrost behaupten, dass die sozialistische Wirtschaftstheorie parallel zum langen Entwicklungsprozess des Sozialismus immer weiter perfektioniert wird.“ (ebenda) „Unsere Erfolge auf allen Gebieten sind untrennbar verbunden mit der Rolle der Partei, mit dem Namen Enver Hoxhas… Deshalb schätzt das Volk die Partei und ist aufs engste mit ihr verbunden, deshalb respektieren Volk und Partei Enver Hoxha und folgen konsequent seinen Lehren.“ (ebenda)
Auf dem 9. Plenum im Januar 1990 tat Alia sogar noch so, als ginge es darum, eine wissenschaftliche Analyse zur Erforschung des Revisionismus mit dem Ziel seiner Verhinderung in Albanien zu erstellen: „Wir müssen jetzt Lehren daraus ziehen, was sich im Osten ereignet hat. Wir müssen die Frage stellen und die Antwort suchen, warum der Revisionismus entstanden ist, was seine objektiven und subjektiven Ursachen waren, was seine Versäumnisse und Übereilungen, seine Fehler und Zugeständnisse waren.“ (Albanien heute 1/90, S. 4) In der gleichen Rede erklärte der „anti-revisionistische Analytiker“ Alia: „Die Zeit, die heutige Lage dulden keine bürokratische Haltung. Ihnen ist ein Ende zu setzen, und je schneller, desto besser. Dies sollten wir, wenn nötig, auch unter irgendeinem Opfer tun, denn jede Etappe der Revolutionierung des Lebens der Partei und des Landes muss ihren Stil und ihre Menschen haben.“ (ebenda, S. 8) Wir wunderten uns damals, von welchem „Opfer“ hier die Rede war. Inzwischen jedoch ist die Sache klar: Die hochzentralisierte Leitung der Wirtschaft, bei mittlerweile fast völlig beseitigter Teilnahme der Massen, hatte beträchtlichen Bürokratismus hervorgebracht. Da Alia als Vertreter der herrschenden Schicht sich eine wirkliche Teilnahme der Massen an der Leitung nicht vorstellen konnte und sie nicht wollte, sah er die Notwendigkeit, die zentrale Leitung der Wirtschaft selbst zu „opfern“. Sein Problem ist nur, dass dies mittlerweile weit radikaler geschieht, als er sich dies damals vorstellte. Die Darstellungsweise Alias, die zu den wirklichen Prozessen im Land und in der Partei im krassen Gegensatz stand, war bis Ende 1990 in der Phrase weitgehend „orthodox marxistisch-leninistisch“. Dies war vermutlich noch erforderlich, um die Parteibasis bei der Stange zu halten; der Zersetzungsprozess war wohl noch nicht so weit vorangeschritten, dass die Masse der Parteimitglieder die Orientierung auf eine relativ offene Wiederherstellung des Kapitalismus akzeptiert hätte. Diese Lügen dienten also dem Sturz des Sozialismus, und daher müssen Alia, Carcani und Co. als revisionistische Betrüger angesehen werden.
In welchem Umfang sie ihren eigenen Lügen glaubten, ist allein ihr eigenes Problem und für die Werktätigen ohne jede Bedeutung; auch Kohl wird sich sicherlich wohler bei der Vorstellung fühlen, er bringe den Menschen im Osten Deutschlands das Heil, als bei der (realistischen) Vorstellung, seine Politik ruiniere im Interesse des Kapitals ihre Existenzgrundlage. Und was Alia, Carcani und Co. betrifft, so kam es ihnen schon deshalb zupass, zumindest einen Teil ihrer revisionistischen Lügen zu glauben, weil eine offene Restauration des Kapitalismus ihren Interessen nicht entsprach; sie wollten ein klassisch revisionistisches Regime, wollten ihre Macht und ihre Privilegien verewigen. Honecker, Mielke und Co. wollten nichts anderes und fanden es offenbar bis zuletzt angenehm, zu glauben, sie würden diese „hehren Ziele“ „im Interesse der Werktätigen“ verfolgen und derartige Zustände seien „sozialistisch“. Engels beschrieb einen derartigen Bewusstseinsprozess treffend wie folgt:
„Die Ideologie ist ein Prozess, der zwar mit Bewusstsein vom sogenannten Denker vollzogen wird, aber mit einem falschen Bewusstsein. Die eigentlichen Triebkräfte, die ihn bewegen, bleiben ihm unbekannt; sonst wäre es eben kein ideologischer Prozess. Er imaginiert sich (stellt sich vor, RM) also falsche respektive scheinbare Triebkräfte. Weil es ein Denkprozess ist, leitet er seinen Inhalt wie seine Form aus dem reinen Denken ab, entweder seinem eigenen oder dem seiner Vorgänger. Er arbeitet mit bloßem Gedankenmaterial, das er unbesehen als durchs Denken erzeugt hinnimmt und sonst nicht weiter auf einen entfernteren, vom Denken unabhängigen Ursprung untersucht, und zwar ist ihm dies selbstverständlich, da ihm alles Handeln, weil durchs Denken vermittelt, auch in letzter Instanz im Denken begründet erscheint.“ (MEW Band 39, S. 97)
Alia, Carcani und Co. müssen nicht unbedingt auf der begrifflichen Ebene gewusst haben, welche Klasseninteressen Triebkraft ihres Handelns waren, doch diese Frage spielt für ihre Beurteilung vom Klassenstandpunkt der Arbeiterklasse keine Rolle. Im Übrigen muss man freilich davon ausgehen, dass sie bei der Darstellung der Lage im Land bewusst gelogen haben, denn sie verfügten zweifellos über Apparate, die ihnen ein mehr oder minder realistisches Bild vermittelten.
Wie wir heute beispielsweise wissen, wurden Honecker, Mielke und Co. durch die Stasi über die Lage in der DDR, insbesondere über die Stimmung in der Bevölkerung, bestens und ohne Schönfärberei informiert (vgl. z.B. „Ich liebe Euch doch alle. Befehle und Lageberichte des MfS.“ Basis-Druck Verlagsgesellschaft Berlin, 1990).
Für die offiziell verbreiteten Lügen findet sich in der Ideologie der herrschenden Revisionisten stets eine Begründung: Diese Lügen sind „zweckdienlich“, dienen der Aufrechterhaltung des Systems, entsprechen der „revolutionären Zweckmäßigkeit“. Ideologie und Zynismus liegen daher in der psychischen Mentalität solcher Revisionisten eng beieinander und bedingen sich gegenseitig. Ein revisionistisches Regime war nicht mehr möglich. Wie gesagt: Alia, Carcani und Co. wollten ein revisionistisches Staats- und Gesellschaftssystem, doch die Umstände ließen dies nicht zu. Die Bedingungen waren anders als in den verschiedenen Ländern des Ostblocks, in denen der Sozialismus bereits spätestens Anfang der 60er Jahre endgültig beseitigt war und in denen sich ca. 30 Jahre lang eine revisionistische Ordnung halten konnte. Diese Länder waren nicht isoliert, und sie hatten weitaus mehr Wirtschaftskraft als das kleine Albanien, das vom Imperialismus erbarmungslos in den Würgegriff genommen wurde. Die Imperialisten taten alles, um die wirtschaftlichen und politischen Schwierigkeiten Albaniens zusätzlich anzuheizen und die PAA in die Knie zu zwingen.
Die Menschen waren nicht bereit, materielle Entbehrungen zu ertragen, wenn sie sahen, dass diejenigen, die von Fürsorge sprachen, sich Privilegien sicherten und den staatlichen Unterdrückungsapparat zum Schutz dieser Privilegien ausbauten. Alia und Carcani versuchten zwar, der besonders schwierigen Lage Albaniens Rechnung zu tragen, indem sie den Betriebsleitern Mitte 1990 weitaus mehr Rechte zugestehen wollten, als dies z.B. in der revisionistischen DDR der Fall war. Doch all dies half nichts mehr. Die Verhältnisse waren bereits zu zerrüttet, um ein irgendwie geartetes revisionistisches Regime noch längere Zeit halten zu können; eine Ausbeuterordnung ist in Albanien nur noch in offen kapitalistischer Form möglich.
Die Führer der PAA stellten sich schließlich hierauf ein und versuchten, einen Weg des Übergangs zum offenen Kapitalismus zu finden, bei dem sie sich einen möglichst großen Teil ihrer Pfründe sichern konnten. Nach den konterrevolutionären Ereignissen im Dezember 1990 wurde ein großer Teil derjenigen Parteiführer geopfert, die den bürokratischen, staatlich-zentralistischen Teil der privilegierten Schicht vertraten, so z.B. der Innenminister Simon Stefani, um die Empörung der Massen über Willkürmaßnahmen des Staatsapparats zu dämpfen. Ferner opferte Alia seinen Wirtschaftsreformer Carcani, der zusammen mit ihm versucht hatte, Ausmaß und Tempo der Reformen in Grenzen zu halten. Weiter erkannten Alia und Co., dass ein Einparteien-Regime der PAA nicht mehr zu halten war; dies würden weder die Massen noch der Imperialismus zulassen. Also führte man eine Wahl mit bürgerlichen Parteien durch. Die PAA-Führung war offenbar durchaus realistisch genug, um ihren „Wahlsieg“ als Pyrrhussieg einzuschätzen: Obwohl sie 2/3 der Sitze errang, bot sie den bürgerlichen Parteien Regierungssessel an. Diese lehnten ab: Sie waren ihrerseits realistisch genug, um zu erkennen, dass sie bessere Voraussetzungen hatten, der PAA ihren Willen aufzuzwingen, wenn die Alleinregierung der PAA erst einmal gescheitert war. Was dann ja auch prompt geschah. Doch worum geht es bei dem Tauziehen zwischen der PAA und den bürgerlichen Parteien? Bereits im Juni-RM (S. 10) haben wir hierzu den damaligen Ministerpräsidenten Fatos Nano (mittlerweile neuer Chef der ehemaligen PAA) zitiert, der zu den Unterschieden in den ökonomischen Programmen der Parteien bemerkte, „dass die einzige Abweichung in der Zeit besteht, die sie für die Umsetzung ihrer Programme und Reformen vorsehen. Wir als Partei der Arbeit sind nicht für übereilte Abenteuer. Wir ziehen in Betracht, dass wir den Arbeitern unter allen Umständen neue Jobs anbieten müssen, bevor ein unrentables Unternehmen schließt.“ (ATA 3.-6. April 1991 S. 16)
Das ist bereits etwas grundlegend anderes als das Wirtschaftsprogramm der Regierung Carcani, die einen klassischen Revisionismus (mit allerdings etwas schwächerem Zentralismus und etwas größerer Eigenständigkeit der Betriebsleiter als beispielsweise in der DDR) angepeilt hatte: Das ist offener Kapitalismus, denn genau diesen wollen die bürgerlichen Parteien, und seit der Regierung Nano eben auch die PAA.
Laut ihrem Wahlprogramm strebt die PAA es an, „das System der zentralen Führung und Verwaltung durch die Mechanismen der Marktwirtschaft zu ersetzen“ (Wahlprogramm der PAA nach ATA 1. 1. 1991). Und da der Kapitalismus ohne Herrschaft der Imperialisten über Albanien nicht zu haben ist, akzeptiert die PAA in Übereinstimmung mit den bürgerlichen Parteien auch diese Herrschaft: Nicht nur die bürgerlichen Parteien, sondern auch die PAA strebt „die volle Integration in Europa“ (Zeri i Popullit nach ATA 23.1.1991), die Abschaffung des Außenhandelsmonopols, die freie Konvertierbarkeit des Lek an.
Unterschiede bestehen wie gesagt nur im Tempo. Wobei es im Übrigen reine Demagogie ist, wenn die PAA wie auch die bürgerlichen Parteien die Abschaffung des Außenhandelsmonopols planen bzw. fordern: Dieses ist seit den Reformen Carcani Mitte 1990 abgeschafft! Denn diese Reformen gestanden dem Einzelbetrieb „Rechte“ auf dem Gebiet „des Exports und des Imports“ zu (Albanien heute 3/1990, S. 10).
Bestehen aber solche Rechte, so ist das Monopol des Staates, also der staatlichen Zentralstelle bezüglich des Außenhandels bereits durchbrochen. Sprechen die PAA und die bürgerlichen Parteien dennoch von „Abschaffung des Außenhandelsmonopols“, so meinen sie viel weitergehende Reformen, nämlich die Beseitigung jeglicher staatlicher Beschränkung des Rechts der Betriebe, nach Gutdünken Außenhandel zu betreiben. Das Programm Carcani mit seinen staatlichen Einschränkungen des freien Flusses von Waren, Kapital und Arbeitskraft ist längst Schnee von gestern.
.
Der 10. Parteitag
Folglich bezogen Alia und Carcani auf dem Parteitag kräftige Prügel. (Die hier verarbeiteten Informationen bezüglich des Parteitags haben wir der bürgerlichen Presse entnommen; die Meldungen der albanischen Nachrichtenagentur ATA werden uns seit einigen Monaten nicht mehr zugeschickt.) Gleich in der Eröffnungsrede griff Gjoni, zu diesem Zeitpunkt 1. Sekretär der PAA, Ramiz Alia an und erklärte, dieser habe den Reformprozess zu spät eingeleitet, da er sich gegenüber einer „alternden und unfähigen“ Elite, die nicht auf ihre Privilegien verzichten wolle, zu nachgiebig gezeigt habe. (Frankfurter Rundschau, 11.6.91)
Selbstverständlich sind hier nicht die Betriebsleiter gemeint, sondern jener Teil der privilegierten Schicht, der die staatlichen Organe besetzt hatte und dessen weitere Existenz nur in einem revisionistischen Regime möglich gewesen wäre. Gjoni griff sodann Carcani sowie die ehemaligen Innenminister Simon Stefan und Hekuran Hisai an. Auch hier ist die Logik klar: Carcani als Urheber der revisionistischen Wirtschaftsreformen, die jetzt bereits überholt sind, und die beiden ehemaligen Innenminister als Exponenten des bürokratischen, staatlichen Teils der privilegierten Schicht. Tatsächlich sollen sieben von elf Politbüromitgliedern aus der Partei ausgeschlossen worden sein. (FR 12.6.91)
Alia durfte seinen Sitz im Politbüro behalten, „vermutlich deshalb, weil er offene Selbstkritik übte und die Mittelmäßigkeit sowie Unfähigkeit der Parteiführung bedauerte“ (FR 12.6.91).
Eine „Selbstkritik“ von bemerkenswerter „analytischer Kraft“, über die der Parteitag anscheinend höchst glücklich war!
Aber was hätte Alia sonst auch sagen können? Etwa: „Ich war wendig genug, mit orthodoxen Phrasen den Übergang in ein klassisch revisionistisches Regime zu versuchen. Ich habe erkannt, dass das nicht funktioniert. Deshalb bin ich damit einverstanden, den offenen Kapitalismus einzuführen und die PAA, jetzt ‚Sozialistische Partei‘, in eine sozialdemokratische Partei zu verwandeln.“
Nein, das konnte er sicher nicht sagen. Es wäre zwar die Wahrheit gewesen, hätte ihm aber gewiss keinen Politbürosessel verschafft, denn die Wahrheit ist nicht immer erwünscht. Wobei man der nunmehr zur SPA gewandelten PAA immerhin zugutehalten muss, dass sie ihren Sozialdemokratismus ehrlich zugibt; hat sie doch die Aufnahme in die Sozialistische Internationale beantragt. Alia und Co. sind also jetzt Genossen von Brandt, Lafontaine und Edzard Reuter. Wir müssen widerrufen, was noch in der Überschrift dieser Artikelserie steht, dass Alia und Co. nämlich Revisionisten seien. Sie sind es bereits nicht mehr. Sie sind Sozialdemokraten. Der Verfallsprozess dieser Leute hat ein derart schwindelerregendes Tempo angenommen, dass sie es sogar geschafft haben, Gorbatschow zu überholen. Auf dem Parteitag kam es zu einem Zwischenfall, als eine Resolution vorgelegt wurde, die Enver Hoxha angriff. Einige Delegierte sollen das Podium gestürmt haben, es soll zu Rufen „Partei, Enver, immer bereit“ gekommen sein. (FR 13.6. bzw. 11.6.) Wir wissen nicht, welche Kräfte hinter diesen Ereignissen stehen. Wir wissen, dass trotz des starken antikommunistischen Klimas im Land Enver Hoxha bei vielen Beschäftigten noch eine hohe Achtung genießt. Gleichzeitig besteht jedoch die Möglichkeit, dass der bürokratische, vor allem auf den Staatsapparat gestützte Teil der privilegierten Schicht, dessen Felle nun in rasendem Tempo davonschwimmen, versucht, solche ehrlichen Stimmungen und Gefühle für seine Zwecke zu nutzen. Derartige Elemente haben bereits nach Envers Tod einen Personenkult um ihn betrieben, beispielsweise das Enver-Hoxha-Museum im Stile einer Kathedrale ausgebaut, um selbst von dem „Glanz“ zu profitieren, Envers revolutionäre Politik aber faktisch im Mausoleum einzumauern. Wer heute in Albanien Envers Werk fortsetzen will, der muss vor allem den widerwärtigen Verfallsprozess der PAA bzw. SPA offen brandmarken, der muss eine radikale Neuorientierung auf die Arbeiterklasse vornehmen, mit alten Bürokraten und neuen Kapitalisten radikal brechen, sie und das Vordringen des Imperialismus energisch bekämpfen. Jegliche „Enver-Nostalgie“, die nicht mit einer solchen Politik verbunden ist, ist der revolutionären Politik Enver Hoxhas geradezu entgegengesetzt.
Bleibt die Frage, welche besonderen Interessen die SPA eigentlich vertritt, wodurch sie sich von den offen bürgerlichen Parteien unterscheidet. Zunächst einmal: Hier ist nach wie vor richtig, was Fatos Nano gesagt hat: Sie unterscheidet sich von den anderen Parteien im Tempo, mit dem der offene Kapitalismus angestrebt wird. Das hat allerdings weniger mit Fürsorge für die Arbeiter zu tun, die angeblich ihre Jobs nicht ersatzlos verlieren sollen, wie Nano demagogisch sagte, und die Arbeiter haben mit ihrem Generalstreik auch deutlich gezeigt, was sie von der „Fürsorge“ eines Fatos Nano halten. Doch welchen Inhalt hat dieser Streit ums Tempo? Nun, je langsamer der Prozess verläuft, desto mehr Zeit haben die Angehörigen der alten herrschenden Schicht (genauer: des Teils, den man mit dem Schlagwort „Betriebsleiter“ kennzeichnen kann), die Posten im Kapitalismus für sich zu reservieren, anstatt sie an die Vertreter der neuen Parteien abzugeben. Wobei das Ganze nur ein Familienstreit ist, der die Beschäftigten nicht berührt, denn die führenden Vertreter der neuen Parteien sind in aller Regel Dissidenten der PAA, also Leute, deren persönlicher Verfallsprozess noch etwas schneller verlaufen ist als der Verfallsprozess der PAA.
Der Streit ums Tempo bei der Einführung des offenen Kapitalismus ist im Übrigen keineswegs etwas Neues. Einen entsprechenden Streit gab es in der Sowjetunion, wo Leute wie Schatalin aufs Tempo drängten und Leute wie Ryschkow als Bremser fungierten (vgl. RM 1/91 S. 13 „Russlandhilfe für die Mafia“).
.
Revisionistische Entartung – Kein Betriebsunfall der Geschichte
So bitter die Niederlage des Sozialismus in Albanien auch ist: Sie liefert lehrreiches Material für das Studium der Bewegungsgesetze des Sozialismus. Sozusagen im Zeitraffer ereigneten sich in Albanien die gleichen Dinge, die in den übrigen ehemals sozialistischen Ländern geschahen; die Sowjetunion benötigte hierfür fast vier Jahrzehnten, und der Prozess, der zur offenen Restauration des Kapitalismus führt, ist dort immer noch nicht vollständig abgeschlossen. Diese Wiederholung widerlegt alle subjektivistischen Betrachtungen, denen zufolge der Revisionismus ein zwar tragischer, aber mehr oder minder zufälliger Betriebsunfall der Geschichte ist, verursacht vor allem dadurch, dass einige Revisionisten finstere Verschwörungen ausbrüten, wie sie den Sozialismus beseitigen können. Gewiss, es liegt uns völlig fern, den subjektiven Verrat der Revisionisten irgendwie zu relativieren; ganz im Gegenteil halten wir es für erforderlich, sie schonungslos als Feinde der kommunistischen und Arbeiterbewegung zu brandmarken. Gleichzeitig gilt aber in Bezug auf die Revisionisten das Gleiche, was Marx in Bezug auf die Kapitalisten und Grundbesitzer schrieb: „Die Gestalten von Kapitalisten und Grundeigentümer zeichne ich keineswegs in rosigem Licht. Aber es handelt sich hier um die Personen nur, soweit sie die Personifikation ökonomischer Kategorien sind, Träger von bestimmten Klassenverhältnissen und Interessen. Weniger als jeder andere kann mein Standpunkt, der die Entwicklung der ökonomischen Gesellschaftsformation als einen naturgeschichtlichen Prozess auffasst, den einzelnen verantwortlich machen für Verhältnisse, deren Geschöpf er sozial bleibt, so sehr er sich auch subjektiv über sie erheben mag.“ (MEW, 23,8.16)
Der Revisionismus ist subjektiver Ausdruck einer objektiven Entwicklungsrichtung der sozialistischen Gesellschaft, die nicht auf die allmähliche Aufhebung, sondern auf die Verfestigung und Aufblähung der Klassenunterschiede gerichtet ist. Eine solche Fehlentwicklung hat objektive und subjektive Ursachen. Die objektiven Faktoren haben vor allem damit zu tun, dass dem Tempo, in dem die Aufhebung der Klassen erfolgen kann, objektive Schranken gesetzt sind. Die Unterschiede zwischen Arbeitern und Bauern, die Unterschiede zwischen Arbeitern und Bauern einerseits und den Spezialisten für Kopfarbeit, insbesondere für leitende Tätigkeiten, andererseits, können nicht sofort aufgehoben werden. All dies macht zum einen den Staat erforderlich, zum anderen die führende Rolle der Partei der Arbeiterklasse. Doch diese führende Rolle muss strategisch gerade darauf gerichtet sein, die Orientierung auf die Aufhebung der Klassen und des Staates und somit auch auf die Selbstaufhebung der Partei zu wahren.
Wird die Orientierung auf die Selbsttätigkeit der Gesellschaftsglieder durch die Orientierung auf die „Fürsorge für die Massen“ durch eine Partei, die „immer recht hat“, die „Sonne und Wind gibt“, ersetzt, so kann es nicht ausbleiben, dass eine solche Partei zunehmend die Interessen der Spezialisten für leitende Tätigkeiten vertritt, dass die Existenz derartiger Spezialisten nicht mehr als eine zeitweilige Notwendigkeit begriffen wird, sondern dass sie beginnen, sich als Herren der Gesellschaft zu fühlen, als herrschende Schicht zu konstituieren.
Marx: „Die materialistische Lehre (gemeint ist der mechanische, also der vormarxische Materialismus, RM) von der Veränderung der Umstände und der Erziehung vergisst, dass die Umstände von den Menschen verändert und der Erzieher selbst erzogen werden muss. Sie muss daher die Gesellschaft in zwei Teile – von denen der eine über ihr erhaben ist – sondieren.“ (MEW 3, S. 5 f.)
Die verspießernden Funktionäre der faulenden sozialistischen Gesellschaften glaubten gerade, sie seien „über der Gesellschaft erhaben“, sie würden die Umstände ändern und damit die Menschen erziehen. In Wirklichkeit hatten die Muttermale der alten Gesellschaft, die im Sozialismus vorhanden sind, diese Funktionäre längst eingeholt und im bürgerlichen Sinne erzogen. Bei alledem darf freilich nicht übersehen werden, dass ein sehr straffer Zentralismus, die Konzentration aller wichtigen Entscheidungen in sehr wenigen Händen, in der Anfangsphase des Sozialismus unumgänglich ist. Diese Anfangsphase kann relativ lange dauern, wenn die Arbeitermacht in einem rückständigen Land gesiegt hat. In der Sowjetunion unter Stalin und im Albanien unter Enver Hoxha war es sicherlich so, dass alle wichtigen Entscheidungen letztlich im Politbüro der Kommunistischen Partei gefällt worden sind.
Da diese Konzentration der Entscheidungskompetenzen dem ökonomischen und kulturellen Entwicklungsstand der Gesellschaft entsprach, war sie fortschrittlich und schloss keineswegs eine breite, schöpferische Initiative der Werktätigen aus. Im Gegenteil: Diese Initiative war vorhanden. Das muss man all denen entgegenhalten, die immer wieder vor sich hinbrabbeln, hier habe es sich um „Ein-Mann-Diktaturen“ gehandelt, die den Rest der Gesellschaft geknebelt hätten.
Wie wäre ohne schöpferische Initiative der Massen die Industrialisierung der Sowjetunion in einer Zeitspanne möglich gewesen, für die die Geschichte kein Beispiel kennt? Wie wäre es möglich gewesen, dass während des 2. Weltkrieges die Versorgungslage besser war als heute, unter Gorbatschow? In Albanien gab es zur Zeit der Befreiung weder Fabriken noch Eisenbahnen, noch Elektrizität, noch Infrastruktur, noch Universitäten, dafür Blutrache und den Schleier, riesige Sumpfgebiete und Malaria. Hat eine „Ein-Mann-Diktatur“ Enver Hoxhas all das geleistet, was es in Albanien heute gibt, ohne schöpferische Initiative der Werktätigen? Lächerlich!
Doch die Leitungs- und Regierungsformen eines sozialistischen Landes können nicht auf alle Zeit unverändert sein. Mit der ökonomischen und kulturellen Entwicklung der Gesellschaft entsteht die Möglichkeit und gleichzeitig die Notwendigkeit, immer breitere Teile der Gesellschaft an Entscheidungsprozessen wirklich zu beteiligen. Und zwar nicht nur an Entscheidungsprozessen bezüglich der Planung und Leitung der Produktion des eigenen Betriebs, sondern bezüglich aller gesellschaftlicher Fragen. Dies bedeutet keineswegs die Aufhebung der führenden Rolle der Partei, denn dafür werden erst im Kommunismus die Voraussetzungen bestehen. Es bedeutet aber, dass diese führende Rolle qualitativ höhere Formen annimmt. Die Politik der Partei muss zunehmend darauf ausgerichtet sein, dass immer mehr Werktätige aufgrund ihrer eigenen Erfahrungen das Notwendige erkennen und umsetzen, in Wahrnehmung ihrer eigenen Interessen, die sie als gesellschaftliche Interessen begreifen.
Bleibt eine solche Entwicklung aus, so nehmen die gleichen Leitungs- und Regierungsformen, die einmal notwendig und fortschrittlich waren, nach und nach reaktionären Charakter an. Die Menschen gewöhnen sich an die Vorstellung, dass die Funktionäre befehlen und die Massen ausführen. Dies fördert bei den Funktionären Kommandoallüren, Dünkel, das Gefühl, allmächtig zu sein, Genußsucht. Bei den Massen geht nach und nach jede kommunistische Initiative verloren; man wartet auf die Befehle von „denen da oben“. Es kommt in allen gesellschaftlichen Bereichen zur Stagnation.
Das Sinken der Produktivität zwingt die herrschende Schicht, nach einem Ausweg zu suchen. Da die kommunistische Perspektive verstellt ist, bleibt als „Rettung“ der Ausbau von Warenkategorien; die private, auf individuellen Gewinn ausgerichtete Initiative soll die verlorengegangene gesellschaftliche Initiative „ersetzen“. Dieser Prozess führt zur Restauration des Kapitalismus: langsam und gemächlich, wie in der Sowjetunion, oder erdrutschartig, wie jetzt in Albanien. Vor einiger Zeit haben wir begonnen, uns mit all diesen Problemen näher zu befassen. Wir werden diese Untersuchungen weiterführen, denn aus dem Sieg des Revisionismus und schließlich des Kapitalismus müssen unbedingt Lehren gezogen werden, wie solche Entwicklungen in Zukunft vermieden werden können. Dabei sind sowohl die objektiven als auch die subjektiven Faktoren von Bedeutung, unter letzteren gerade auch die Fehler der Kommunistischen Parteien, die eine konterrevolutionäre Entwicklung begünstigt haben. Wir tun dies nicht mit einer besserwisserischen Pose, dass „wir alles richtig gemacht hätten“. Es geht um etwas anderes: Die geschichtliche Periode, die mit der Oktoberrevolution begann und die jetzt endgültig beendet ist, war der erste weltweite Ansturm auf den Kapitalismus.
.
Ein zweiter Ansturm wird folgen
Manche Einseitigkeiten, Mängel und Fehler, die beim ersten Ansturm mangels geschichtlicher Erfahrungen vielleicht unvermeidlich waren, können beim zweiten Ansturm vermieden werden, wenn man die Erfahrungen nur auswertet. Ein Fehler war es wohl, den Sozialismus zu statisch zu betrachten, nicht zu sehen, dass er sich notwendig entwickeln muss: wenn nicht in fortschrittlicher Richtung, dann in reaktionärer.
Enver Hoxha sagte beispielsweise 1978 in seiner Rede „Die proletarische Demokratie – wahre Demokratie“ über den Unterschied zwischen den kapitalistisch-revisionistischen Staaten und dem sozialistischen Albanien:
„Worin liegt dieser Unterschied? In erster Linie in der wirtschaftlichen Basis, in der Struktur der Gesellschaft und im Überbau, der diese Basis widerspiegelt. In den kapitalistischen und revisionistischen Gesellschaftsordnungen stehen sich Basis und Überbau antagonistisch gegenüber, während sie in unserer sozialistischen Gesellschaft ohne jeden Klassenantagonismus sind und diesbezüglich fortwährend vervollkommnet werden.“ (Abdruck in „Weg der Partei“ 5/78, S. 3f.)
„Ohne jeden Klassenantagonismus“: Das war eine Überschätzung der Einheit und Geschlossenheit der sozialistischen Gesellschaft. Wie sich gezeigt hat, bestanden beträchtliche Widersprüche sowohl in der ökonomischen Basis als auch im Überbau, und zwar auch Widersprüche antagonistischer Art. Die tiefe Kluft in der Gesellschaft, die sich heute auftut, kann nicht von heute auf morgen entstanden sein. Eine solche Orientierung, wie sie Enver Hoxha hier vornahm, verbaute aber den Blick auf die realen Widersprüche. Sie ist eine Erklärung z.B. für das Verhalten von Jugendfunktionären, die noch vor zwei Jahren einen bürgerlichen Einfluss auf die Jugend vollständig in Abrede stellten (vgl. Juni-RM). Und Enver Hoxha sagte in der gleichen Rede: „Bei uns existiert in den geeignetsten und demokratischsten Formen vollständige Freiheit für die werktätigen Massen… Nicht nur in den Staatsorganen, sondern auch in den Versammlungen der Werktätigen finden, wenn über einen Plan oder ein Gesetz diskutiert wird, viele Diskussionen statt, die durch eine große Volksaussprache gekennzeichnet sind, welche alles Vorauszusehende und Nichtvorauszusehende in Erwägung ziehen, um die geeignetste Lösung dafür zu finden.“ (ebenda, S. 6)
Wie schon gesagt: Eine solche schöpferische Initiative der Massen hat es gegeben, daran besteht für uns kein Zweifel. Doch warum sind solche Superlative und Übertreibungen erforderlich, die ein Klima schaffen müssen, dass alles so gut ist, dass es gar nicht mehr verbesserungsfähig wäre? „Vollständige Freiheit für die Werktätigen“ – als wäre das in einer Klassengesellschaft möglich; es herrschen die „geeignetsten“ und „demokratischsten“ Formen; sogar das „Nichtvorauszusehende“ wird in Erwägung gezogen. All dies verstellt doch den Blick auf die Notwendigkeit von Veränderungen!
Elf Jahre später konnte sich ein Ramiz Alia hinstellen und demagogisch erklären: „Das innere Leben der Partei, der kämpferische Geist und die Debatte werden nicht nur durch Intervention von oben, sondern auch durch die Vermischung des Begriffs der Einheit mit dem der Einstimmigkeit zum Erblassen gebracht. Nicht wenige Genossen meinen fälschlicherweise, dass es die Einheit verletze, wenn über einen Kommunisten oder Kader, über ein Problem oder eine Haltung nicht einstimmig abgestimmt werde.“ (Abdruck Verlag RM 1989, S. 23)
Der Mann mag zwar bereit sein, schamlos zu lügen, doch er ist sicherlich nicht so dumm, Erscheinungen, die jeder kennt, anders zu beschreiben, als sie sind. Im Gegenteil: Revisionisten wie Alia greifen reale Probleme auf, um sie in konterrevolutionärer Weise zu „lösen“. Wie er diese Probleme „gelöst“ hat, ist bekannt. Aber sie waren vorhanden und hätten einer sozialistischen Lösung bedurft. Und wenn die Lage in der Partei schon so war, dass jedes nicht einstimmige Verhalten als Verletzung der Einheit und damit als tendenziell feindlich angesehen wurde, dann kann man sich vorstellen, wie die Lage in der Gesellschaft insgesamt war!
1978, zum Zeitpunkt von Envers oben angerührten Zitaten, war die Lage sicherlich noch nicht so gewesen, doch Envers Darstellung, es bestehe eine „vollständige“ und somit nicht mehr verbesserungsfähige Freiheit für die Werktätigen, war sicherlich nicht geeignet, einer solchen negativen Entwicklung entgegenzutreten. Dies ist nur ein Aspekt, den wir herausgreifen, um zu verdeutlichen, dass die Entwicklung in Albanien wie auch in den anderen ehemals sozialistischen und später revisionistischen Ländern möglichst genau untersucht werden muss. Wir werden dabei zwischen Fehlern von Marxisten-Leninisten und konterrevolutionären Handlungen der Revisionisten stets die Klassenlinie ziehen. Enver Hoxha hätte, als der große Marxist-Leninist, der er war, die negativen Entwicklungen entweder rechtzeitig erkannt, um die Entartung von Partei, Staat und Gesellschaft zu verhindern, oder er hätte sich den Revisionisten offen entgegengestellt, hätte direkt an die wirklichen Kommunisten und die Werktätigen appelliert, und sei es um den Preis, die Macht zu verlieren und erneut um die Macht kämpfen zu müssen.
Den Alia und Co. war dieser Weg nicht möglich, da sie untrennbar mit der privilegierten Schicht verbunden waren und sind, deren Klasseninteressen sie vertraten. Daher hatten sie keinen anderen Weg, als sich gegen die Arbeiterklasse, gegen den Sozialismus, gegen den Marxismus-Leninismus zu stellen.
.
Unterschiede zwischen den sowjetischen und albanischen Revisionisten
Zwischen der revisionistischen Entwicklung in der Sowjetunion und in Albanien besteht nicht nur im Tempo, sondern in gewisser Hinsicht auch im Inhalt ein bestimmter Unterschied. Dieser Unterschied scheint uns, kurz gesagt, in folgendem zu bestehen: Der Machtantritt der sowjetischen Revisionisten, der rasch nach Stalins Tod erfolgte, geschah nicht unmittelbar als Folge eines auf die gesamte Gesellschaft wirkenden Drucks, jedenfalls nicht in erster Linie. Er war in erster Linie die Emanzipation der privilegierten Schicht zur herrschenden Klasse. Schon am Tag nach Stalins Tod schlossen sich das ZK, der Ministerrat und das Präsidium des Obersten Sowjets im Kreml ein und verteilten die Posten neu. (Enver Hoxha, Die Chruschtschowianer, Tirana 1980, S. 14) Offenbar hatten viele auf diesen Tag gewartet, und die entsprechenden Pläne lagen schon bereit (vgl. ebenda, S. 15). Die revisionistischen Führer hatten sicherlich schon zu Lebzeiten Stalins beträchtliche Privilegien, doch andererseits standen sie unter einem Druck, den Chruschtschow einmal so beschrieb: Wenn man zu Stalin gerufen worden sei, habe man nie gewusst, ob es zum Mittagessen gehe oder ins Gefängnis. Denn Stalin war tatsächlich bereit, gegen solche Arbeiterfeinde wie Chruschtschow mit allen Mitteln vorzugehen, wenn er hinter ihren heuchlerischen Beteuerungen von „Treue zur Partei“ ihr wahres Gesicht erkannte. Die Revisionisten waren also ständig gezwungen, ihre wahren Absichten zu verschleiern. Ein solcher Druck macht die Privilegien natürlich in gewisser Weise schal. Trotz aller Fäulniserscheinungen existierte eine – wenn auch geschwächte – Diktatur des Proletariats, die die Revisionisten daran hinderte, so zu schalten und zu walten, wie sie es wollten.
Nach Stalins Tod gingen sie also sofort daran, diesen Zustand zu ändern. Um den Druck, der auf ihnen lastete, zu beseitigen, begannen sie, in verschiedener Hinsicht ein liberaleres Klima zu schaffen: Gegenüber offenen Konterrevolutionären, vor allem aber auch gegenüber dem Imperialismus, dem recht bald die Möglichkeit zu friedlichem Verhalten bescheinigt wurde. Die Begriffe der Diktatur des Proletariats und der Partei der Arbeiterklasse wurden beseitigt und durch den „Staat des ganzen Volkes“ und die „Partei des ganzen Volkes“ ersetzt. All diese Erscheinungen waren unserer Meinung nach nicht in erster Linie eine Reaktion auf den offenen Ausbruch einer Krise, sondern Maßnahmen, die der Emanzipation der neuen bürgerlichen Elemente zur Klasse dienten. Die Krise schwelte zwar, war aber noch nicht offen ausgebrochen. Sie bestand darin, dass die aktive Rolle der werktätigen Massen nicht ausgeweitet, sondern immer mehr eingeschränkt wurde, sodass dieser Umstand bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung der straff zentralistischen Leitung zur ökonomischen Fäulnis führte.
Doch diese Fäulnis war vorerst nur latent vorhanden, und uns scheint, dass Chruschtschow und Co. von diesen Prozessen keine Ahnung hatten, dass sie an ihre Allmacht glaubten, dass sie an die nahe Zukunft eines „Kommunismus“ glaubten, in dem sie in Saus und Braus leben konnten und auch für die Werktätigen genügend „Gulasch“ abfallen würde, sodass die herrschende Stellung der Revisionisten-Clique nicht in Gefahr geraten würde. Freilich erwiesen sich diese Vorstellungen bald als Illusion. Die Produktivität ging zurück, die Massen waren unzufrieden, die Fäulnis trat offen zutage. Die Revisionisten begannen mit Wirtschaftsreformen, die die Warenelemente der Produkte verstärkten, langsam aber sicher auf den Kapitalismus hinausliefen. Ab diesem Zeitpunkt waren sie nicht mehr agierende Kraft, sondern sie wurden immer stärker von den Umständen getrieben; man schwärmte immer weniger vom „Kommunismus“ und beschränkte sich immer mehr auf „realistisches“ Krisenmanagement. Doch in der ersten Zeit nach Stalins Tod war dies noch nicht so; die Chruschtschowianer schienen das Gesetz des Handelns in der Hand zu haben und hatten es bis zu einem gewissen Grade auch tatsächlich; sie betrieben die Emanzipation ihrer Klasse. Anders in Albanien. Hier wurden die alten Formen aufrechterhalten, bis die Krise offen ausbrach. Gewiss, die Formen müssen in vieler Hinsicht bereits hohl gewesen sein, sonst wäre Albanien dem Kapitalismus nicht wie eine reife Frucht in den Schoß gefallen, selbst wenn man den enormen Druck des Imperialismus auf das kleine Albanien in Betracht zieht. Doch diese Formen waren vorhanden; die privilegierte Schicht hatte zwar jeden Gedanken an die Selbsttätigkeit der Gesellschaftsglieder, die ihre herrschende Stellung einschränken würde, aufgegeben, aber sie hatte sich noch nicht zur herrschenden Klasse emanzipiert. Die Zuspitzung des inneren Fäulnisprozesses und des äußeren Drucks führte zu einer Situation, in der die bisherige labile Lage nicht aufrechterhalten werden konnte. Die Werktätigen fühlten immer deutlicher, dass sie in der Gesellschaft nichts zu sagen hatten, ihr Interesse an der Produktion sank, die Versorgungslage verschlechterte sich; gleichzeitig nahm der Druck des Imperialismus rapide zu. Für die Revisionisten ergab sich daraus die Notwendigkeit, die Elemente der Warenproduktion zu verstärken und gleichzeitig ihren Frieden mit dem Imperialismus zu machen. Da sie im Unterschied zu den Chruschtschowianern bereits bei Beginn dieses Prozesses von den Umständen getrieben waren und nicht in erster Linie als agierende Kraft erscheinen, kann der Eindruck entstehen, sie seien in erster Linie Opfer der widrigen Umstände bzw. Opfer des Imperialismus, und aus einer solchen Betrachtung heraus kann ein gewisses Mitleid mit den albanischen Revisionisten aufkommen. Unserer Überzeugung nach ist eine solche Haltung jedoch völlig fehl am Platze. Entscheidend für den Verrat der albanischen Revisionisten, die sich nunmehr sogar in Sozialdemokraten verwandelt und Gorbatschow überholt haben, ist ihr bürgerliches Klasseninteresse, ihr Bestreben, egal unter welchen Umständen ihre privilegierte Stellung zu erhalten, und zwar so weit wie möglich.
Damit stehen sie der Arbeiterklasse und dem Kommunismus feindlich gegenüber. Die Kommunisten auf der ganzen Welt haben alle Veranlassung, diese Verräter als Feinde zu behandeln. Würden die Kommunisten anders handeln, so würden sie die prinzipielle Trennungslinie zum Revisionismus und überhaupt zum Klassenfeind aufweichen; dies würde in letzter Konsequenz dazu führen, dass sie aufhören würden, Kommunisten zu sein.
Lest die Klassiker und studiert den Marxismus-Leninismus!
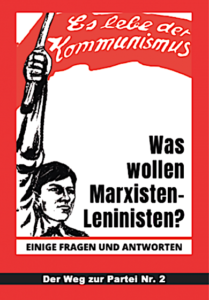 |
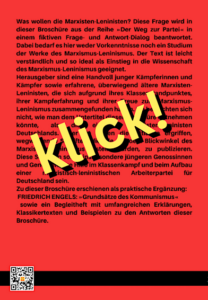 |
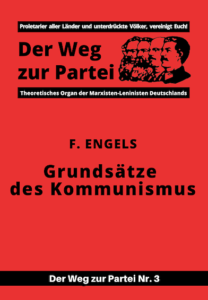 |
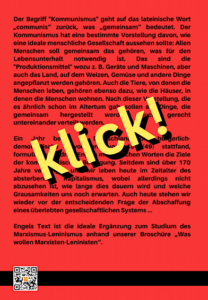 |
|
| bestellen | LESEPROBE | …. | bestellen | LESEPROBE |
.
.
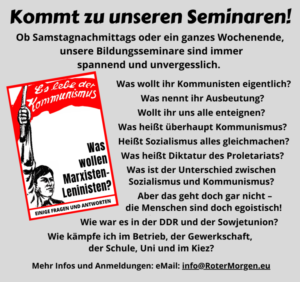 Mehr dazu: Info@RoterMorgen.eu
Mehr dazu: Info@RoterMorgen.eu

Antworten