
Redaktion – 10. Februar 2025
Die russische Landwirtschaft erlebte in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts zwei entscheidende Wendepunkte: 1917, als die Bolschewiki nach ihrer Revolution den Boden an die Bauern verteilten, und 1929, als die Kollektivierung der Landwirtschaft einsetzte. Diese Veränderungen hatten tiefgreifende Auswirkungen auf das Land und die Menschen. Die Landwirtschaft war geprägt von Chaos und Anarchie, was die Effizienz verhinderte und die Einführung moderner Methoden erschwerte. In seiner Broschüre von 1937 schilderte Kalinin die Zustände vor der Kollektivierung, die von individuellen, ineffizienten Anbaumethoden geprägt waren. Lenin und die Bolschewiki standen vor der Herausforderung, die alte Struktur der Landwirtschaft zu überwinden und die Bauern zu mobilisieren, um die revolutionären Ziele zu erreichen.
.
Dieser Artikel befasst sich mit:
Einleitung
Bedeutung der Jahre 1917 und 1929 für die russische Landwirtschaft
Umbruch durch die Bodenverteilung 1917 und die Kollektivierung 1929
Die Situation vor der Kollektivierung
Schilderung der agrarischen Zustände durch Kalinin (1937)
Probleme der individuellen Landwirtschaft: Unkoordiniertheit, schlechte Ernten, ineffiziente Bewirtschaftung¹
Auswirkungen der Anarchie in der Landwirtschaft auf die Mechanisierung
Die Rolle der Oktoberrevolution
Herausforderungen der Revolution: kein reines Stufenmodell
Die Bedeutung des Kleinbürgertums und seine Schwankungen
Lenins Einschätzung der Bauern: Rückständigkeit und Notwendigkeit der politischen Schulung²
Die Organisation der Bauernschaft
Bauernsowjets und ihre Funktion
Spezielle Maßnahmen zur Politisierung der Landarbeiter
Verstaatlichung des Großgrundbesitzes: Musterwirtschaften und Umverteilung
Das Bündnis zwischen Stadt und Land
Revolutionäre Diktatur des Proletariats und der Bauernschaft
Gegensatz zu opportunistischen Strömungen innerhalb der Partei
Lenins Vorwurf gegenüber den Intellektuellen und kleinbäuerlichen Anarchismus³
Der sozialrevolutionäre Bauernkrieg
Vorrevolutionäre Unruhen und Hungerrevolten
Plünderungen, Angriffe auf Klöster und Gutsbesitzer
Rolle der Soldaten und zunehmende Politisierung des Bauernkampfes
Der bolschewistische Einfluss auf die Bauernbewegung
Einfluss der Bolschewiki auf die Agrarbewegung
Die Veränderung der Bauernschaft im Oktober 1917
Die Zeitung „Bednota“ als Medium der Agitation
Theoretische und historische Verweise
Marx und Engels über den Bauernkrieg
Vergleich zu anderen Revolutionen, insbesondere zur Pariser Kommune⁴
Die Bedeutung der Oktoberrevolution für die Bauernfrage
Abkehr vom westlichen Fokus auf städtische Revolutionen
Zusammenhang zwischen industrieller Entwicklung und Bauernbewegung
Notwendigkeit einer politischen Führung der Bauern durch das Proletariat
Fazit
Die Bauernfrage als zentraler Bestandteil der russischen Revolution
Langfristige Auswirkungen auf die Agrarpolitik der Sowjetunion
Kontraste zwischen Theorie und Praxis im revolutionären Prozess⁵
1917 und 1929 sind für die Entwicklung der russischen Landwirtschaft in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts die beiden markantesten Jahre. 1917 verteilten die Bolschewiki nach ihrer erfolgreichen Revolution den russischen Boden an die große Mehrheit der Bauern, und 1929 rollte eine Kollektivierung der Landwirtschaft über die UdSSR. Wie es vor der Kollektivierung in der Landwirtschaft herging, schildert uns Genosse Kalinin 1937 in seiner Broschüre „Was hat die Sowjetmacht den Werktätigen gegeben?“: „… der eine Bauer sät eine Getreideart, ein zweiter eine andere; der eine Bauer verfügt über Qualitätssaatgut, der andere über schlechtes Saatgut; das Getreide des einen Bauern wird bereits abgeerntet, während auf dem Streifen des Nachbarn das Getreide noch grün ist; der eine sät Hafer, der andere, gleich daneben, setzt Kartoffeln. Dieses Durcheinander in der Landwirtschaft – und bei der kleinen Einzelwirtschaft war es nicht zu überwinden – führte dazu, dass die Felder der Bauern verwahrlosten und eine schlechte Ernte hergaben.“1 Die Anarchie in der Landwirtschaft verhinderte die Anwendung von Maschinen in der Landwirtschaft, verhinderte kollektive Arbeitsprozesse, die erst von schwerer körperlicher Arbeit befreien. Also ein Bündel von Widersprüchen, vom Privateigentum bedingt, die aus ihrer Komplexität heraus den Vortrag über den Revolutionsverlauf polydimensional ausgestalten. Es gibt kein reines Stufenmodell einer Revolution, keine hat reine, in sich geschlossene Phasen, sondern komplexe Übergänge, über die nur wenige mit geschultem Auge eine gewisse Übersicht gewinnen, denn jede Revolution weist ihre spezifischen Zickzackbewegungen, auch rückwärtige, auf. Das galt besonders für Russland, ein Land, in dem das Kleinbürgertum überwog, die schwankende Klasse schlechthin, und so zeigte auch gerade die Oktoberrevolution, dass es unmöglich ist, einen Revolutionsverlauf im Voraus bis ins Detail zu bestimmen – die groben Umrisse vielleicht, die Hauptwendungspunkte –, denn der konkrete Verlauf erwies sich, wie Lenin eingestehen musste, als „origineller, eigenartiger, bunter“.2 In den Bauernsowjets wollte Lenin die unterste Klasse der Tagelöhner und Landarbeiter gesondert zusammengefasst wissen; dem Volk sollte bis in seine untersten Schichten die Kunst der Staatsverwaltung gelehrt werden. Immer wieder betonte Lenin die Notwendigkeit, aufklärerisch unter der rückständigsten Masse, den Landarbeitern in ihrer ganzen Verlorenheit, den Dienstboten und Hilfsarbeitern zu wirken, und ebenso notwendig war für ihn eine selbstständige Klassenorganisation des Landproletariats, ein besonderer Sowjet der landwirtschaftlichen Lohnarbeiter und Tagelöhner, der Bauern ohne Pferd. Für Lenin waren zwei Schritte in der Agrarbewegung gegen die jahrhundertelange Gewohnheit an die Einzelwirtschaft besonders wichtig: der ländliche Sondersowjet, die Gründung einer Landarbeitergewerkschaft und die Herausgabe einer speziellen Landarbeiterzeitung, denn die bürgerlichen Parteien hatten den landwirtschaftlichen, von allen Arbeitern am meisten ausgebeuteten Lohnarbeiter Russlands, den schwächeren Bruder des Fabrikarbeiters, der diesem hinterherhinkt, gleichsam übersehen. Nach 1917 gab es in Russland Kongresse russischer Bäuerinnen und Arbeiterinnen, Kongresse, die, wie Clara Zetkin richtig bemerkte, „wir gar nicht kennen“. Besonders in den Dörfern hatte sich die verfluchte Macht der Gewohnheit als Gottgewolltes eingenistet. Besonders den Bauern kommt der Gedanke oft und leicht über die Lippen: „Es ist immer so gewesen und es wird immer so sein.“ Jetzt vertrat und verbreitete Lenin den Gedanken, das Gottgewollte zu zertrümmern, indem das Inventar der Gutsbesitzer, nicht das der armen Bauern, zu beschlagnahmen ist, um es unbedingt in erster Linie den armen Bauern und Bäuerinnen unentgeltlich zur Benutzung zu überlassen. Der große Bruder in der Stadt, der in den Großbetrieben seine eigene Kraft spürt, muss dem kleinen im Dorf, den Knechten und Tagelöhnern, helfen, sich aufzurichten. Und zweitens die Verwandlung von landwirtschaftlichen Großbetrieben in Musterwirtschaften, „die gemeinschaftlich, zusammen mit den Landarbeitern, mit ausgebildeten Agronomen und unter Verwendung des Viehbestands der Gutsbesitzer und ihrer Geräte usw. bestellt werden. Ohne diese gemeinsame Bestellung unter der Leitung der Sowjets der Landarbeiter wird man nicht erreichen, dass der gesamte Grund und Boden in die Hände der Werktätigen übergeht.“ 3. War die Pariser Kommune noch gescheitert, weil die Provinzen Frankreichs nicht mit ihr gingen, so verstärkte Lenin die Notwendigkeit, unbedingt den Schulterschluss zwischen Stadt und Dorf zu vollziehen und in Russland eine revolutionär-demokratische Diktatur des Proletariats und der Bauernschaft – d. h. mit der in dieser sozialen Zusammensetzung liegenden ungeheuren Massenkraft im Rücken das Übergewicht über die Reaktion durch die Organisierung der Avantgarde des Proletariats qua Partei zur herrschenden Klasse anzustreben. Gegen die neuiskristischen Opportunisten, die analog der ökonomistischen Beschränkung auf den wirtschaftlichen Kampf der Bourgeoisie aus einer vordergründigen Logik heraus die Führungsrolle in der demokratischen Revolution überlassen wollten, beharrte Lenin, der sie als „Epigonen des Ökonomismus“ verspottete, mit dem Vorwurf, der intellektuell-opportunistische Flügel der Partei fürchtete den Sieg der Revolution, auf den Führungsanspruch der Arbeiterklasse mit ihrem Hauptverbündeten an ihrer Seite, zumal er die russische Bourgeoisie für inkonsequent, sprich: bündnisbereit mit dem Zarismus hielt und die kleinbürgerlichen Demokraten als schwankend einschätzte – schwankend zwischen der Bourgeoisie und dem Proletariat, schwankend zwischen der Liebe zu den Arbeitern und der Furcht vor ihrer Diktatur. Lenin wusste von der Abneigung individualistisch gesinnter Intellektueller gegen Disziplin und Organisation, die aus ihrem Edelanarchismus heraus nicht zu praktizieren verstehen, dass das Proletariat im Kampf um die Macht keine andere Waffe besitzt als die Organisation. In einem kleinbäuerlichen Land war der zur Spontaneität neigende Anarchismus präsent, und Lenin sah nach der Machteroberung in ihm einen Hemmschuh beim bewussten und massenhaften Vormarsch zu einer höheren Arbeitsproduktivität. Es galt, die Energie des Anarchischen der Revolution in sowjetstaatliche Bahnen zu lenken. Lenin band Revolutionäre mit der Mentalität von Soldaten an sich, nicht solche mit der Mentalität von Intellektuellen, die niemals taugliche Parteiarbeiter werden können. Und die Bauern? Ohne kämpferische Bauern in revolutionären Bauernkomitees geht es besonders in Russland nicht, ohne sie, aber auch ohne das Proletariat, ist an eine Vernichtung des Zarismus, unter dem die Gutsbesitzer die entscheidende Klasse bildeten, und an eine Behauptung der Macht der Werktätigen gar nicht zu denken. Eine wirklich revolutionäre Kraft stellt in Russland nur das Volk dar, und das Volk besteht eben aus dem Proletariat und der Bauernschaft. Besonders in Russland mit seinem übermächtigen Anteil von Kleinbauern in der sozialen Zusammensetzung des Volkes waren jahrzehntelange richtige Beziehungen des Proletariats und seiner Partei zu ihnen von ausschlaggebender Bedeutung. Geht man von den industriellen Erfolgen der Sowjetunion aus, so scheinen diese ja anfänglich und über den Anfang hinaus gestimmt zu haben: Nimmt man für das Jahr 1913 für die Industrieproduktion die Zahl Hundert an, so geht die Kurve zunächst steil nach unten. 1920 auf 25, 1923 auf 75, aber 1932 war die Kurve auf 300 gestiegen. Aller Anfang war allerdings schwer, und die Diskrepanz zwischen Theorie und Praxis himmelschreiend weit auseinander. Hatte Engels 1847 in den ‚Grundsätzen des Kommunismus‘ geschrieben, durch die große industrielle Revolution, durch die ‚Große Industrie‘ sei man nun endlich in der Lage, die Produktion ins Unendliche zu vermehren, die Bahn des Kommunismus könne beschritten werden, so lag in der Anfangspraxis Mangelwirtschaft vor. Von der Taktik her sollte die Diktatur des Proletariats und der Bauernschaft den Boden vorbereiten für die Diktatur des Proletariats und der armen Bauern. Die erste Revolution wächst in die zweite hinüber, ein Revolutionskonzept, das in Russland nach der Dauer einer menschlichen Schwangerschaft aufgegangen war, nicht global. Hier ist nur revolutionäre Impotenz zu konstatieren. Zwei Bezüge zu Marx und Engels sind in diesem Zusammenhang aufschlussreich. Erstens: In der stalinschen Geschichte der Kommunistischen Partei der Sowjetunion (Bolschewiki) wird Lenins Revolutionskonzept nicht nur als eine Vertiefung des Marxismus ausgegeben, sondern auch als ein ganz neues Revolutionskonzept. Das ist sicher überzeichnet, denn für Deutschland hatten die beiden Klassiker 1848 ein vergleichbares Konzept vorgelegt: Im Manifest deuten sie die bürgerliche Revolution „nur als unmittelbares Vorspiel einer proletarischen Revolution“.4 Der Kerngedanke war jedenfalls vorhanden, wenn auch seine nähere Konkretisierung und Ausführung Lenin vorbehalten blieb. Zweitens: Marx hatte bekanntlich Engels in einem Brief vom 16. April 1856 mitgeteilt, dass es um die Revolution in Deutschland gutstünde, wenn sie ergänzt werden würde „durch irgendeine zweite Ausgabe des Bauernkrieges“. Thomas Müntzer hatte 1525 gepredigt, dass die hohen Herren es selbst machen, dass der Bauer gegen sie aufstehe. Den Bauern wurde alles versprochen und nichts wurde gehalten, die Bauern wurden so regelrecht in einen Bauernkrieg hineingetrieben. Diesen Landkrieg gab es in Russland 1917 schon vor der Oktoberrevolution mit wechselnder Intensität, begleitet von Hungerrevolten und Alkoholexzessen. Die kriegerische Intensität nahm naturgemäß zur Erntezeit ab. Der sozialrevolutionäre Bauernkrieg, der die Bezeichnung auch verdient, weil Sozialrevolutionäre ihn anführten, war bunt und vielfältig, zugleich robust und elementar und zunächst nur erst gegen die Überbleibsel der Leibeigenschaft gerichtet. Die Nonnen in den Klöstern gerieten in Panik. Er wuchs sich zur bis dahin größten Agrarrevolution in der Geschichte aus. Ganze Gutshöfe des Feudaladels wurden, bereits nachts beginnend, auseinandergenommen und seine Bestandteile von den armen Bauern in alle vier Himmelsrichtungen mitgenommen. Holz wurde geschlagen, besonders zum kalten Winter hin, und die großen Gutsbesitzer sprachen vom Wald- und Wiesenfrevel.5 Aber der Bauernkrieg war nicht vom Himmel gefallen, die Agrarterroristen waren jahrhundertelang die Feudaladeligen, und nun wurde ihnen die Rechnung grausam und gnadenlos vorgelegt. Nur eine sofortige Übergabe des Bodens an die Bauern hätte Mord und Totschlag verhindert. Es wird von Fällen berichtet, dass Kulaken erschlagen wurden, weil sie an den Plünderungsfeldzügen nicht teilnehmen wollten. Viele Kulaken nahmen aber teil und waren wegen des Besitzes von Pferden und Fuhrwerk bei den Plünderungen im Vorteil. Der Kulak wurde erst 1918 zum Feind und half zunächst noch mit bei der Wegräumung der Gutsbesitzer. Erst ab 1918 trug die am meisten bisher politisierte Bauernbewegung in der Geschichte einen proletarischen Stempel. Zum Oktober hin steigern sich die Agrarunruhen rapide, auch Kinder nehmen jetzt an den Plünderungen teil, und die reichen Bauern schreien immer lauter über Anarchie. Sicher überzeichnet Trotzki das Bild: Das Dorf war für Trotzki zum Herbst hin völlig aus allen Vernunftangeln gefallen „und ließ an Wildheit des Kampfes alle ‚Irrenhäuser der Städte‘ weit hinter sich“.6 Zur Erntezeit flaute die Intensität der Bauernerhebungen naturgemäß ab, stieg dann aber wieder weiter an. Gegen die Offensive der Bauern im kalten Spätherbst, nach dem Einbringen der Ernte hatten sie Zeit für Politik, bot die Regierung über hundert Truppenentsendungen auf – mit mäßigem Erfolg, denn die Soldaten sympathisierten mit ihren Klassengenossen. Die Entsendung vermeintlich zuverlässiger Truppen war ein besonders von Kerenski gehandhabtes Mittel konterrevolutionärer Politik. Die nach der Oktoberrevolution veröffentlichte geheime militärische Korrespondenz zeigte, dass die Initiative dazu von ihm, nicht von den Generälen ausging, ebenso wie die nicht nachlassenden Versuche, revolutionäre Regimenter unter Protest von Belegschaften der großen Fabriken, insbesondere der Putilow-Werke, aus Petrograd zu verlegen – wiederum unter der Federführung von Kerenski. Die Bolschewiki richteten bei nur geringem Einfluss die in Bewegung geratenen Bauern keineswegs rein destruktiv aus, immer suchten die Revolutionäre nach Wegen der Expropriation mit möglichst wenig Sachschaden. Nur in der Staatsfrage war Lenin unerbittlich, vom alten Staatsapparat durfte kein Stein auf dem anderen stehenbleiben. Viele einfache Soldaten wurden zu dieser Herbstzeit aus Soldaten des Imperialismus Soldaten des Bauernkrieges und nahmen im Dorf eine führende Stellung ein. Sie kamen von der Front und brachten zum Teil bolschewistisches Gedankengut mit. Das Dorf vernahm den Namen ‚Lenin‘. Auch Soldatenfrauen sprachen sich mittlerweile für Plünderungen aus. „Die abwiegelnde Führung der sozialdemokratischen Lehrer, Gemeindeschreiber und Beamten wurde durch die Führung der vor nichts zurückschreckenden Soldaten abgelöst“.7 Es erschien im Namen der Bolschewiki eine Bauernzeitung ‚Bednota‘ (‚Armut‘). Die Bauern wandelten sich und verfolgten aufmerksam den Wandel in den Sowjets, in denen ihre alte Partei der Sozialrevolutionäre immer mehr Boden verliert, die Bolschewiki ihn immer mehr gewinnen. Durch den Bolschewismus aber wird die Bodenfrage an die Entwicklung der Sowjets gebunden.
Das Ganze bewegte sich 1917 im Spannungsfeld zwischen den historischen, im Kommunistischen Manifest erwähnten Tatsachen, dass die Bourgeoisie das Land der Herrschaft der Stadt unterworfen und den Orient vom Okzident abhängig gemacht hat8 und der Voraussicht von Friedrich Engels im Anti-Dühring, dass eine umfassende proletarische Revolution zur Auflösung der großen Metropolen führen werde.9 Der Maoismus (in der Figur Lin Biaos) wollte dieses Ziel dadurch erreichen, dass im ersten Kriegsakt die Dörfer die Städte einkreisen sollten. Was bisher im Marxismus im Argen lag, die Bauernfrage und das Verhältnis der proletarischen Partei zu ihr, bekam jetzt durch Lenins Beachtung der Völker des Ostens eine ganz andere Gewichtung und erschien in einem ganz anderen Licht. Die Peripherie der Weltgeschichte und ihr Zentrum rückten zusammen. Aber was heißt überhaupt Peripherie und Zentrum? Hatte nicht auch die antifeudale europäische Bewegung, deren Höhepunkt die Revolution von 1789 war, ihren Ausgangspunkt in den Städten Oberitaliens? In einem Land, das nur durch ein Meer von Afrika getrennt war und in dem der Sieg des Königtums über den Feudalismus die Vorstufe von 89 war? Alle Marxisten wollten an die Macht und müssen an die Macht wollen, die meisten westeuropäisch geprägten sahen die Machtzentren nur in den Metropolen (der Glanz der Pariser Kommune!), fixierten sich nur auf diese und gerieten in eine Befangenheit, aus der heraus es nur so zu Fehlbeurteilungen der russischen Oktoberrevolution im Osten Europas kommen musste. Es konnte doch nicht ausbleiben, dass ein so qualitativer Sprung vom Konkurrenzkapitalismus des 19. Jahrhunderts zum Monopolkapitalismus des 20. Jahrhunderts für das Verhältnis der urbanen und ruralen Arbeiterbewegung ganz folgenlos bleiben konnte. Vergleicht man die Leninsche ‚Prawda‘ mit marxistischen Zeitungen in Westeuropa, so fällt auf, dass die ‚Prawda‘ eine regelmäßig erscheinende Spalte hatte, die den Dorfkorrespondenten vorbehalten war. Bei den im 19. Jahrhundert steckengebliebenen Marxisten war das Wort „Dorfkorrespondent“ nicht geläufig und ist es auch heute bei den Linken in Deutschland nicht. Der Bauer kommt in der Politik gar nicht vor, was allein schon ein Anzeichen einer konterrevolutionären Grundeinstellung ist. Die Metropolen glitzern im Licht und in den Dörfern ist es dunkel. Marx und Engels hielten es für wünschenswert, wenn eine proletarische Revolution in Westeuropa von einer Art zweiter Auflage des Bauernkrieges unterstützt werden würde, Lenin, Stalin und Mao („Die Salven der Oktoberrevolution brachten den Marxismus nach China“) gingen definitiv davon aus, dass die proletarische Revolution ohne Bauernbewegung, ohne Bauernkrieg nicht siegen kann. Aber alle drei waren keine Bauernphilosophen; die Problematik bestand in einer Hegemoniefrage: In Westeuropa hatten die Bauern ihre primitive Scholle bereits aus der Hand bürgerlicher Revolutionäre erhalten, in Russland weigerten sich selbst die Sozialrevolutionäre, obwohl sie die Partei der Provinz waren, in der Kerenskiperiode, auch die in den Sowjets, praktisch, nicht theoretisch (leere Versprechungen), den Bauern Land zu geben, was Lenins Revolutionskonzept sehr entgegen kam, das immer von der Notwendigkeit einer Führung des von ihm in revolutionärer Hinsicht aufgewerteten Bauern durch den Proletarier ausging. Und die Eigenart der Oktoberrevolution bestand gerade darin, dass in ihr zum ersten Mal in der Weltgeschichte Arbeiter Bauern politisch führten, während der Pariser Kommune funktionierte dies gerade nicht. „Seit über 20 Jahren gibt es in Rußland eine sozialdemokratische Massenbewegung des Proletariats (wenn man von den großen Streiks im Jahr 1896 anrechnet). In dieser großen Zeitspanne, über zwei große Revolutionen hinweg, zieht sich durch die ganze politische Geschichte Rußlands wie ein roter Faden die Frage: Wird die Arbeiterklasse die Bauern vorwärts, zum Sozialismus führen, oder wird die liberale Bourgeoisie sie rückwärts zerren, zur Versöhnung mit dem Kapitalismus ?“10. Die Sowjets waren durch die Führung der kleinbürgerlichen Parteien in die haltlosen Versprechungen der bürgerlichen Regierungen verstrickt, wie denn auch die oberen Schichten des Kleinbürgertums, die wohlhabenden Bauern und ein Teil der Kleinbesitzer, an der Fortsetzung des imperialistischen Krieges interessiert waren. Man darf von kleinbürgerlichen Ideologen nicht verlangen, dass sie die Interessen der Kapitalisten von denen des Landes unterscheiden können, dass sie den annexionistischen Charakter der bürgerlichen Politik offenlegen, sie waren mitverantwortlich für die blinde Vertrauensseligkeit der bäuerlichen Massen gegenüber der bürgerlich-junkerlichen Regierung, dass sie dieser unter der Losung der „revolutionären Vaterlandsverteidigung“ folgte. „In dieser Vertrauensseligkeit liegt die Wurzel des Übels unserer Revolution“.11. Proletarier und Halbproletarier folgten dieser, obwohl sie ihrer Klassenlage nach nicht an den Profiten der Kapitalisten und am imperialistischen Krieg interessiert waren. Die Losung aus dem Kommunistischen Manifest, dass die Arbeiter kein Vaterland haben, wurde nur von der kleinen bolschewistischen Partei hochgehalten. Annexion (Eroberung) bestimmte Lenin als „gewaltsames Festhalten eines fremden Volkes in den Grenzen eines gegebenen Staates“. 12. Es brauchte sehr viel Aufklärungsarbeit, bis erkannt werden konnte, dass die Beendigung des Krieges mit einem System- und Regierungswechsel zusammenhängt. „ … denn wenn die ökonomische Herrschaft der Kapitalisten nicht untergraben wird, wird alles nur auf dem Papier bleiben …“.13. Die Untergrabung der ökonomischen Herrschaft der Kapitalisten muss zur völligen politischen Unschädlichmachung der Ausbeuter führen. Dazu mussten sich zwei Bewegungen gegeneinander bewegen: der sinkende Einfluss der Menschewiki und Sozialrevolutionäre im Proletariat und der steigende der Bolschewiki. Kommt es hier zum Umschlag von Quantität in Qualität, so haben wir einen weltgeschichtlichen Gehalt vor uns. Lenin sah 1917 im dritten Jahr des ersten Weltkrieges die Möglichkeit, dass anders als in Westeuropa der russische Bauer das Land aus den Händen der durch eine Revolution an die Macht gekommenen Arbeiterklasse erhalten kann und politisch nicht der russischen Bourgeoisie folgt, sondern dem Proletariat. Und so kam es dann auch. Millionen und Abermillionen Bauern ergriffen das Gewehr Hand in Hand neben den zahlenmäßig kleinen, aber schlagkräftigen städtischen Industriearbeitern und die bolschewistischen Revolutionäre mussten diesen mächtigen Menschenwall wie einen Augapfel hüten, ihn immer homogener machen, ihn immer mehr schließen und auf die Überwindung des Gegensatzes zwischen Bauer und Industriearbeiter hinarbeiten. Nur das Kollektiv garantiert den Sieg bei Stalingrad. Unter dem Zarismus lagen dreihundert Jahre Unterdrückung, dass den Bauern in der Nacht der ganze Körper von der Tagesarbeit weh tat, wie es Tschechow in seinem Theaterstück ‚Die Bauern‘ 1897 auf die Bühne brachte. Und dreihundert Jahre nationale Unterdrückung, so dass es nach der Oktoberrevolution zu einer „Explosion nationaler Bewegungen“ 14. kommen musste. Nicht nur in der Landwirtschaft hatte durch die Parzellierung des Bodens eine Bewegung stattgefunden, die einer vom Bolschewismus angestrebten Kollektivität widersprach, auch die Autonomiebestrebungen der Nationen verlief gegen den proletarischen Internationalismus. Beides mussten die Bolschewiki mit verkniffenem Gesicht gewähren lassen, beides wird Rosa Luxemburg in ihrer im Gefängnis in Berlin geschriebenen Kritik der Revolutionspolitik den Bolschewiki vors Gesicht halten. Beides hängt ja zusammen: Der Bauer wurde oft doppelt geknechtet, nicht nur vom Grundherren, sondern auch als Nichtrusse. Sie hat nicht gesehen, dass der Bauernkrieg gegen die Grundherren oft einen nationalen Krieg einschloss, dass die Bauernbefreiung ohne Befreiung der Nationen nicht möglich war. Zudem haut ihre Kritik an der bolschewistischen Revolutionspolitik in eine ähnliche Kerbe wie Kautsky, sowohl in der Demokratiefrage als auch in der Frage der wissenschaftlichen Organisation der Arbeit, die gerade in der Landwirtschaft durch den ‚Run‘ auf die Privatscholle verhindert wurde als auch im industriellen Sektor den Expropriationen hinterher hing. Lenin gab das zu, es erwies sich, dass es in einer revolutionären Epoche viel leichter ist, die Macht zu erobern, aber schwieriger, sie richtig zu gebrauchen. Damit bildeten sich zwei Gewichte, ein kulakisches und ein national-chauvinistisches aus, die einen Höhenflug des Kommunismus hemmten. Unter dem Zaren stand die Produktion von Produktionsmitteln, nicht von Konsumgütern im Vordergrund, die Rüstung und die Eisenbahn waren ihm wichtiger als das Wohl seiner bäuerlichen und proletarischen Untertanen. Die Werktätigen in den Städten waren noch nicht lange vom Dorf getrennt, Heiko Haumann spricht von „Bauern-Arbeiter“15., es bestanden noch enge Beziehungen zum Dorf, was der Revolution und dem zentralen Problem der Brotversorgung des Landes zugutekam, die auf die kommunikative Verbindung der Fabrikarbeiter mit der Masse der Bauern, auf Vereinbarungen zwischen den Sowjets der Arbeiterdeputierten und den Sowjets der Bauerndeputierten, politisch auf ihr Bündnis, ökonomisch auf den Austausch Geräte gegen Lebensmittel angewiesen war. Ohne Zweifel ist diese Austauschbeziehung zwischen Stadt und Dorf, in der nach der Februarrevolution das Geld an Bedeutung verlor, elementar für den Bestand des Sozialismus, ihre geringste Störung kann immer den Ansatz einer Wirtschaftskrise beinhalten. Schon vor der Oktoberrevolution gab es vielfach Güteraustausch ohne Vermittlungsfunktion des Geldes, Bedarfsgüter für die Bauern gegen Brotgetreide für die Städter, Syndikate in der Industrie waren mit der Scholle auf dem Land verbunden, wie überhaupt der Kapitalismus im Gegensatz zu den vorkapitalistischen Systemen der Volkswirtschaft alle Wirtschaftszweige in engste Verbindung und gegenseitige Abhängigkeit gebracht hat. Das Primat der Urbanität sollte zerstört werden.
1. Kalinin: Was hat die Sowjetmacht den Werktätigen gegeben?. Verlagsgenossenschaften Ausländischer Arbeiter in der UdSSR, Moskau, 1937, Seite 15
2. Lenin: Briefe über die Taktik, Werke Band 24, Dietz Verlag Berlin, 1960, Seite 26 und 313
3. Lenin: Erster Gesamtrussischer Kongress der Bauerndeputierten, Werke Band 24, Dietz Verlag Berlin, 1960,506
4. Karl Marx, Friedrich Engels: Manifest der Kommunistischen Partei, Werke Band 4, Dietz Verlag Berlin, 1977,493
5. Die Axt war in der französischen Revolution das Symbol für die Guillotine, in der russischen Revolution wurden mit ihr die Wälder guillotiniert.
6. Leo Trotzki: Geschichte der russischen Revolution, Oktoberrevolution, Mehring Verlag, Essen, 2010, Seite 312.
7. a.a.O., Seite 318f.
8. Karl Marx / Friedrich Engels: Manifest der Kommunistischen Partei, Werke Band 4, Dietz Verlag Berlin, 1977,466
9. Friedrich Engels: Herrn Eugen Dührings Umwälzung der Wissenschaft, Werke Band 20, Dietz Verlag Berlin, 1960, Seite 277.
10.Lenin: Aus dem Tagebuch eines Publizisten, Werke Band 25, Dietz Verlag Berlin, 1960, Seite 284.
11.a.a.O., Seite 298.
12.Lenin: Konfusion, Werke Band 24, Dietz Verlag Berlin, 1960, Seite 432.
13.Lenin, Siebente Gesamtrussische Konferenz der SDAPR (B) (Aprilkonferenz), Werke Band 24, Dietz Verlag Berlin, 1960, Seite 258.
14.Andreas Kappeler: Russland als Vielvölkerreich, Entstehung / Geschichte / Zerfall, München, 1993, Seite 295.
15.Heiko Haumann (Herausgeber): Die Russische Revolution 1917, Böhlau Verlag, Köln Weimar Wien, 2007,19. Für Heiko Haumann wird die Oktoberrevolution für das Streben nach einer besseren Welt lebendig bleiben. (Vergleiche a.a.O., Seite 156).
Dieser Artikel fußt auf eine Vorlage von Heinz Ahlreip. Eine Weiterveröffentlichung des Textes ist gemäß einer Creative Commons 4.0 International Lizenz ausdrücklich erwünscht. (Unter gleichen Bedingungen: unkommerziell, Nennung der verlinkten Quelle (»Der Weg zur Partei«) mit Erscheinungsdatum).
.
Lest die Klassiker und studiert den Marxismus-Leninismus!
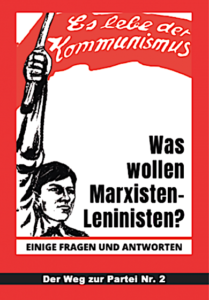 |
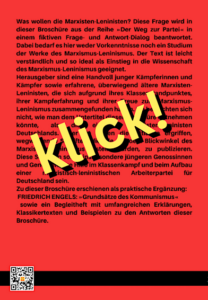 |
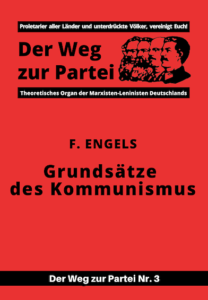 |
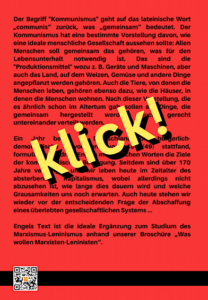 |
|
| bestellen | LESEPROBE | …. | bestellen | LESEPROBE |
.
.
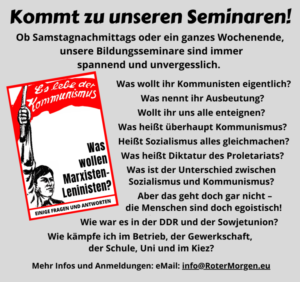 Mehr dazu: Info@RoterMorgen.eu
Mehr dazu: Info@RoterMorgen.eu

Antworten