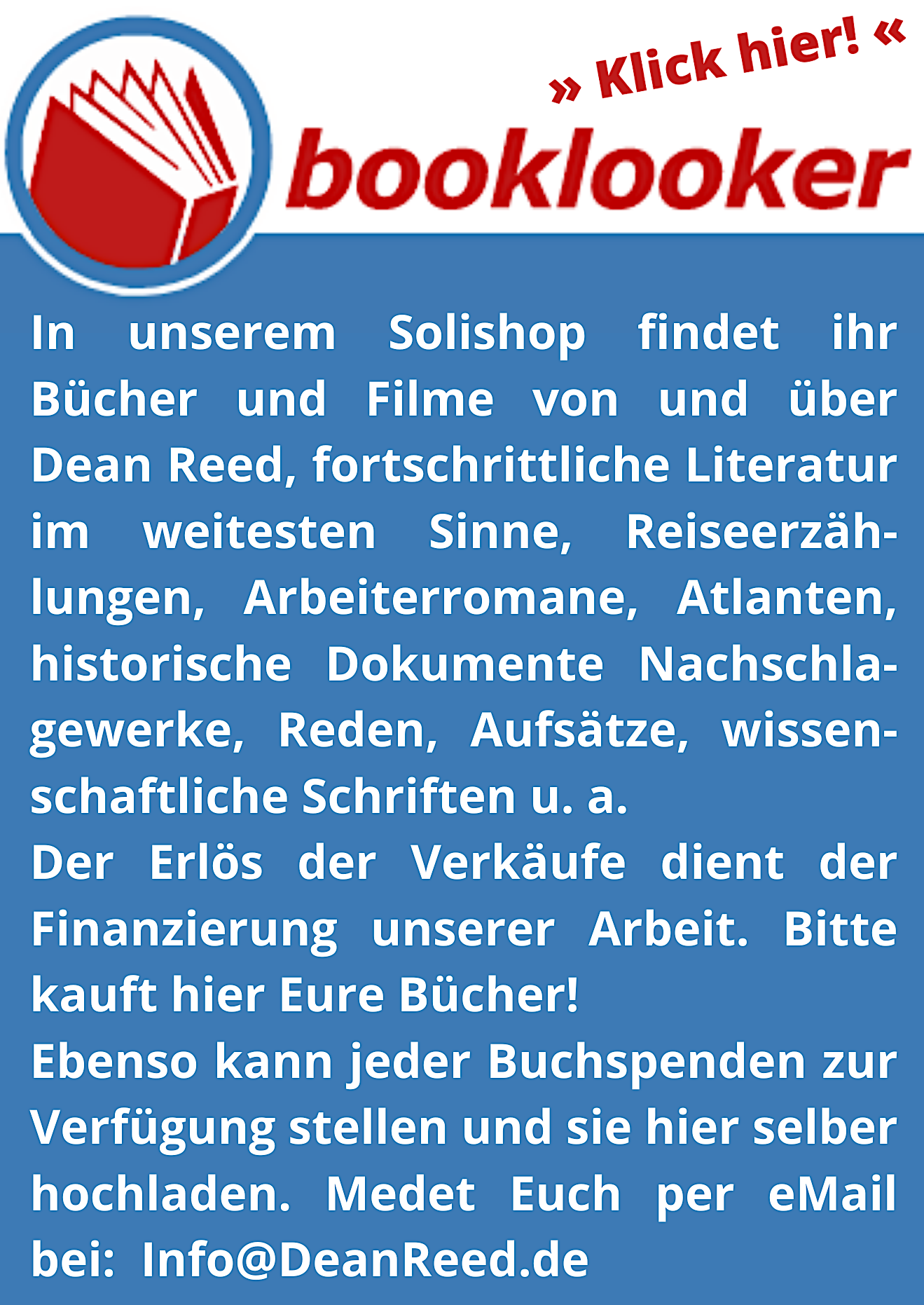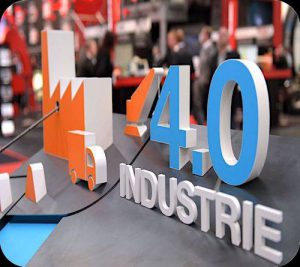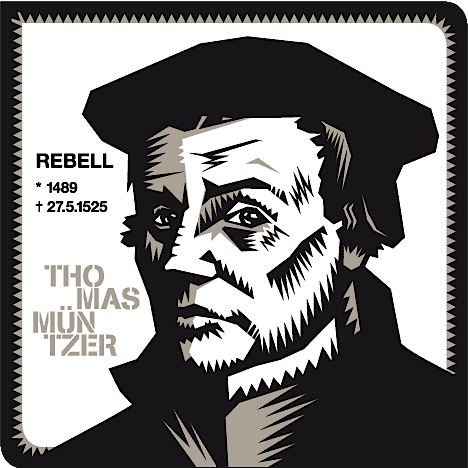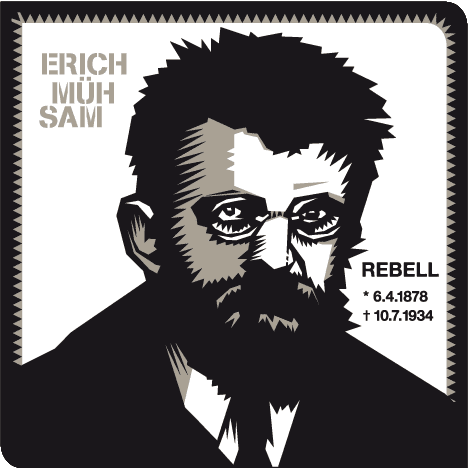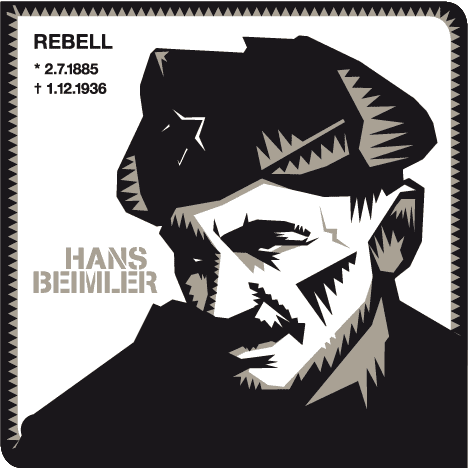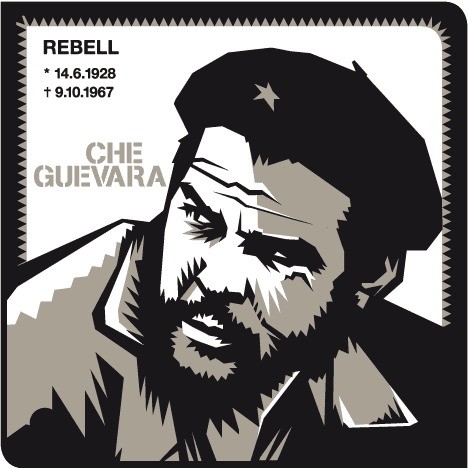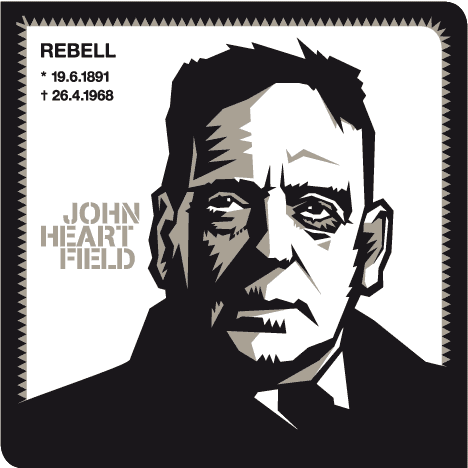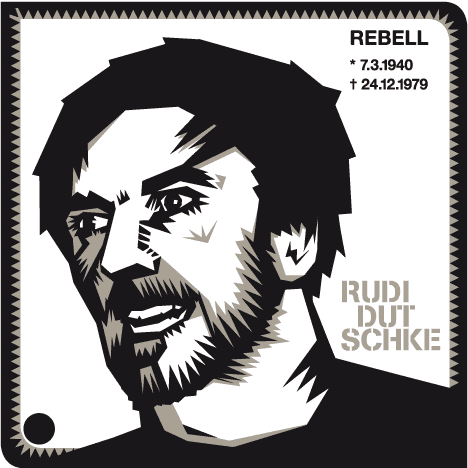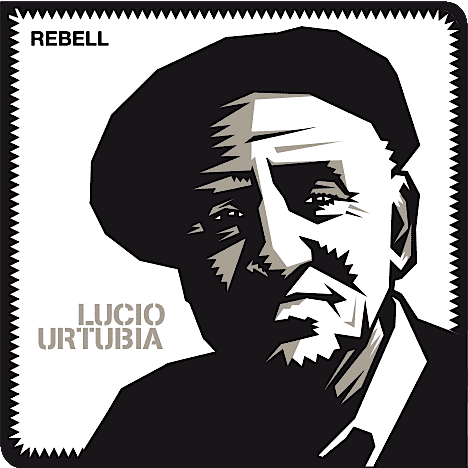Materialschleppen in Zeitlupe
Besonders an dieser Serie ist, dass sie sich stilistisch nicht mehr viel von Serien bei Internetanbietern à la Netflix unterscheidet. So sind die einzelnen Folgen mit ca. 20 Minuten sehr viel länger als für Bundeswehr Youtube-Serien üblich, die bislang eher 5-10 Minuten lang waren. Auch dies lässt sie mehr wie eine Netflix Produktion erscheinen. Ein weiteres für Serien typisches Element, das sehr prominent in „Survival“ auftaucht, ist der sogenannte „Cliffhanger“, also das Beenden einer Episode oder Folge nicht am Ende einer Handlung, sondern kurz vor dem Ende. Um Spannung zu erzeugen und den Zuschauer dazu zu bringen, auch noch die nächste Folge anzuschauen, werden bestimmte Handlungselemente über das Ende der Folge hinausgezögert. Dieses Stilmittel wird in „Survival“ schonungslos eingesetzt, am offensichtlichsten am Ende einer Folge in der eine Soldatin (die einzige weibliche Teilnehmerin des Lehrgangs) sich trauen muss von einer Brücke ins Wasser zu springen und sie es dann erst am Anfang der nächsten Folge tatsächlich tut.
Die wichtigsten Neuerungen, die „Survival“ mitbringt, sind aber filmischer Natur. Weg sind die wackeligen Handkameras und simplen Kameraeinstellungen, wie man sie aus den vorherigen Bundeswehrserien kennt. Alles sieht sehr viel professioneller aus. Viele Weitwinkelaufnahmen und Totalen, ein starker Einsatz von Luftaufnahmen und Zeitlupe. Damit wirken die Aufnahmen geplanter und inszenierter und sogar eigentlich langweilige und belanglose Szenen wie das Laufen auf einem Feldweg oder das Schleppen von Material sehen aus, als wären sie entweder aus einem Actionfilm oder einem US Army Werbespot. Die professionelle Inszenierung zeigt sich auch in einem gekonnten Einsatz von Musik. Die Bundeswehr hat seit der Serie „Mali“ immer einen Titelsong für jede Serie. Für „Survival“ ist das „Black Warrior“ von Luciano Ugo Rossi & Von Hemingway & William Riddims aus dem Album „Swagger & Attitude 3“. Dabei wird das Wort “warrior”, also „Krieger“ aus dem Liedtext immer dann gespielt, wenn in den Augen der Serienmacher etwas Außergewöhnliches geleistet wird. Die Action-Film-Tricks erzeugen stellenweise einige vollkommen absurde Szenen: Materialschleppen aufgepeppt durch Zeitlupe und dramatische Musik.
.
Videospiel-Ästhetik
In Folge vier sagt einer der Ausbilder: “Wir sind hier nicht in der Halo Welt oder so’n Scheiß, hier gibt es keine Respawns, das ist Reality, okay?”. „Halo“ ist ein bekanntes Videospiel, in dem man aus der Ich-Perspektive Außerirdische abschießt. Ein „Respawn“ ist der Begriff für das Wiederauferstehen des Charakters nachdem er im Videospiel gestorben ist. Es ist auffällig, dass die Struktur der Serie Ähnlichkeiten mit dem klassischen Aufbau eines „Ego-Shooters“ aufweist. Der Anfang der Serie ähnelt einem „Tutorial“, also dem ersten Abschnitt, in dem man in das Spiel eingeführt wird und die notwendigen Befehle lernt, um es zu spielen, die Spielregeln sozusagen. Der Rest der Serie ist in verschiedene Aufgaben strukturiert, die die SoldatInnen erfüllen müssen um den Lehrgang abzuschließen, ähnlich wie man in vielen Spielen dieser Art nacheinander verschiedene Missionen abschließen muss, um das Spiel zu beenden. Auch die Kamera verstärkt diesen Eindruck. Der Titelsong der Serie war außerdem ebenfalls der Titelsong eines bekannten Videospiel-Turniers, das kurz vor der Premiere von“ Survival“ stattfand, was natürlich auch Assoziationen hervorruft. Insgesamt ist diese Assoziation aber nicht so eindeutig und klar, um zweifelsfrei sagen zu können, das war hier geplant. Es ist aber trotzdem auffällig und etwas, was man für zukünftige Bundeswehr-Serien im Kopf behalten sollte, besonders wenn man bedenkt, in welchem Zusammenhang diese Entscheidungen der Serienmacher stehen: Auch an anderer Stelle versucht die Bundeswehr mit ihren Rekrutierungsanstrengungen nun schon seit Jahren an dieses Gamer-Publikum heranzukommen, wie sich exemplarisch an ihrer Werbung in Köln während der Spiele Messe „Gamescom“ 2018 zeigen lässt.
In jedem Fall stieß die Videospiel-Ästhetik von „Survival“ selbst der in der Regel eher militärnahen „Welt“ unangenehm auf: „Interessanterweise spielt ‚Survival‘ mit einer bestimmten Art von Ästhetik, um junge Menschen zu erreichen, die mit Videospielen wie dem Ego-Shooter ‚Call of Duty‘ aufgewachsen sind. […] Krieg als Ästhetik? ‚Survival‘ greift Motive des Videospiels auf, vom Logo bis zum Titel, der an den Survival-Modus erfolgreicher Spiele wie ‚Fortnite‘ erinnert. ‚Fortnight‘, so heißt übrigens auch ein Song aus dem Soundtrack. Was unterscheidet die Serie von einem Videospiel oder Actionfilm? Im Videospiel ist der Kampf ein Abenteuer, der Krieg ist cool. Und auch „Survival“ ist supercool! Wenn wir aber Videospiele und Actionfilme konsumieren, wissen wir um die Abstraktion. In „Survival“ sehen wir echte Soldaten, die vielleicht in echte Kriege ziehen werden.“
.
Von wegen unpolitisch
Die wohl offensichtlichste Botschaft dieser Serie ist, wie hart es bei der Bundeswehr ist, aber auch wie cool. Immer wieder wird von den TeilnehmerInnen erzählt, dass sie schon viel gehört haben über den Lehrgang und dass es wohl in der Bundeswehr Horrorgeschichten darüber gäbe. Die Serie ist insgesamt von der Idee durchzogen, dass je größer die Strapazen der Beteiligten, desto cooler die Leute, die sie aushalten. Alles unterstützt diese Idee – von den aufreibenden Ansprachen der AusbilderInnen bis hin zur Betonung, wie einzigartig der Lehrgang sei. Begleitend wird alles durch die Kameraführung und die Musik zu heroischen Kraftakten erhoben.
Wie bereits angesprochen geht es in „Survival“ nicht um Krieg, sondern darum, im Wald zu überleben. Das ist eine Verschleierung der echten Verhältnisse in der Bundeswehr. In der Realität sind die meisten SoldatInnen keine EinzelkämpferInnen oder Mitglieder einer Spezialeinheit, Bundeswehralltag ist es auch nicht, von einer Brücke ins Wasser zu springen und im Wald Feuergefechte zu üben. Auch auf die Funktion dieser harmlos anmutenden Übungen wird nicht eingegangen, nämlich das Lernen des möglichst effektiven Tötens von Menschen für die imperialistischen Kriege der BRD. Es ist eine absolute Entpolitisierung der Bundeswehr: Aus Armee wird Abenteuer.
Diese Entpolitisierung der Bundeswehr gelingt dadurch, dass man eher verschweigt, dass es hier um Kriege geht. Dies wurde zum Beispiel in der Vorgängerserie „KSK – Kämpfe nie für dich Allein“ unter anderem dadurch erreicht, indem die Bundeswehr einen Zivilisten mit den SoldatInnen mitschickte. Sich mit den für die Serie maskierten KSK-SoldatInnen zu identifizieren, deren Namen man nicht kennt, ist schwieriger, als mit einem unmaskierten Zivilisten, der die Welt des KSK sozusagen gleichzeitig mit dem Publikum entdeckt und für den das auch alles neu ist. Das lenkt natürlich super davon ab darüber nachzudenken, ob man es eigentlich richtig findet, dass deutsche SoldatInnen den Kampf im Dschungel üben. Da die Leute, die von diesen Serien primär angesprochen werden sollen, selber keine SoldatInnen sind, ergibt es Sinn für die Bundeswehr eine Figur einzubauen, mit der sich der Durchschnitts-Youtube-Zuschauer eher identifizieren kann, mit der er mitfiebern kann. So eine Figur fehlt in „Survival“, denn dort sind alle Figuren so konzipiert, dass sich das Publikum mit ihnen identifizieren kann. Bei „KSK“ ging es darum, die Elite der deutschen Armee als übermenschlich und unerreichbar darzustellen. Bei „Survival“ geht es dagegen darum, dass die TeilnehmerInnen des Lehrgangs eigentlich ganz normale Menschen sind. Implizit sollen damit die ZuschauerInnen mit der Botschaft angesprochen werden, dass auch er oder sie an diesem Lehrgang teilnehmen könnte, was natürlich wieder ein Aufruf ist, zur Bundeswehr zu kommen. Wie wird das in der Serie erreicht? Man lernt die SoldatInnen nicht, wie etwa bei „KSK“, bewaffnet und in Flecktarn kennen, sondern man lernt am Anfang der Serie die wichtigsten Figuren in Zivil kennen und erlebt dann praktisch ihre Transformation von ZivilistInnen in SoldatInnen. Uniform anlegen, Haare abrasieren und in den Bus steigen. Nun ist der vorher sehr normal aussehende Mensch zu einem, aus Sicht der Serie, coolen Bundeswehrsoldaten, einem „Warrior“ geworden. Die Transformation vom „normalen Menschen“ zum aufregenden Bundeswehr-Soldaten ist natürlich ein Teil des Versprechens der Bundeswehr an potentielle RekrutInnen und damit ein Rekrutierungswerkzeug. Dass man sich mit den SoldatInnen in der Serie identifiziert, wird aber noch durch andere Faktoren bestärkt. Die SoldatInnen und das Publikum haben beide keine Ahnung, wie der Lehrgang aussehen wird und man findet praktisch zusammen heraus wie anstrengend er wird und was einen noch erwartet. Kurz gesagt, die SoldatInnen werden in „Survival“ nicht primär als Kampfmaschinen, sondern als Menschen dargestellt, denen die Bundeswehr die Möglichkeit bietet, über sich selbst hinauszuwachsen.
.
Politikfreie Propaganda
Das ändert jedoch nichts daran, dass „Survival“, wie alle anderen Bundeswehrserien, trotz seiner oberflächlichen Politiklosigkeit Propagandamaterial mit definierten politischen Zielen und hochpolitischen Inhalten ist. Die Ideologie, die in der Serie transportiert wird, ist widersprüchlich. Einerseits ist sie klassisch neoliberale Propaganda. Alle können es schaffen, es ist nur eine Frage „des Willens“ (der vom Himmel fällt, natürlich), begleitet von einem Element von „die stärksten setzen sich durch“. Passend zu dieser neoliberalen Ideologie ist das Bild des auf sich allein gestellten und unabhängigen Einzelkämpfers oder eben des „Warriors“, zu dem die SoldatInnen hier schließlich ausgebildet werden. Ebenfalls passend dazu ist, dass der Ausbilder betont, dass alles um sie herum (Natur) ihnen feindlich gesinnt sei, was die Idee eines autarken und unabhängigen Kämpfers gegen seine Umgebung untermauert und damit perfekt in die neoliberale Vorstellung des Individuums im allgegenwärtigen Konkurrenzkampf des Kapitalismus passt.
Andererseits sind auch Vorstellungen von Kameradschaft und Teamwork in „Survival“ präsent. Das scheint auf den ersten Blick widersprüchlich mit der eben genannten Vorstellung des autarken Kriegers. Dieser Widerspruch wird jedoch dadurch aufgelöst, dass hier Teamwork und Kollektiv primär mit “Führen” verbunden wird. Die Einheit des Teams besteht nicht als Kollektiv, sondern aus dem starken, autarken neoliberalen Individuum (das den Lehrgang „Führer einer auf sich gestellten Gruppe“ abgeschlossen hat) an der Spitze und allen anderen darunter. Dem Zuschauer und potentieller RekrutIn wird suggeriert, SoldatIn sein, bedeute Führen. Das ist natürlich Schwachsinn: Für die meisten bedeutet SoldatIn sein Folgen und nicht Führen.
Abschließend lässt sich sagen, dass die Bundeswehr mit „Survival“ zwar keinen Kurswechsel hingelegt, sie aber ihr bestehendes Format verbessert und besser auf ihre Zielgruppe zugeschnitten hat. Auffällig ist besonders die verbesserte filmische Qualität der Serie und der wie schon in den letzten Serien deutliche Fokus auf „besondere“ Kräfte innerhalb der Bundeswehr. Dass hier nicht über Krieg und dessen Folgen geredet wird, war zu erwarten, verdeutlicht aber wieder den reinen Werbe- und Propagandacharakter dieser Serien.