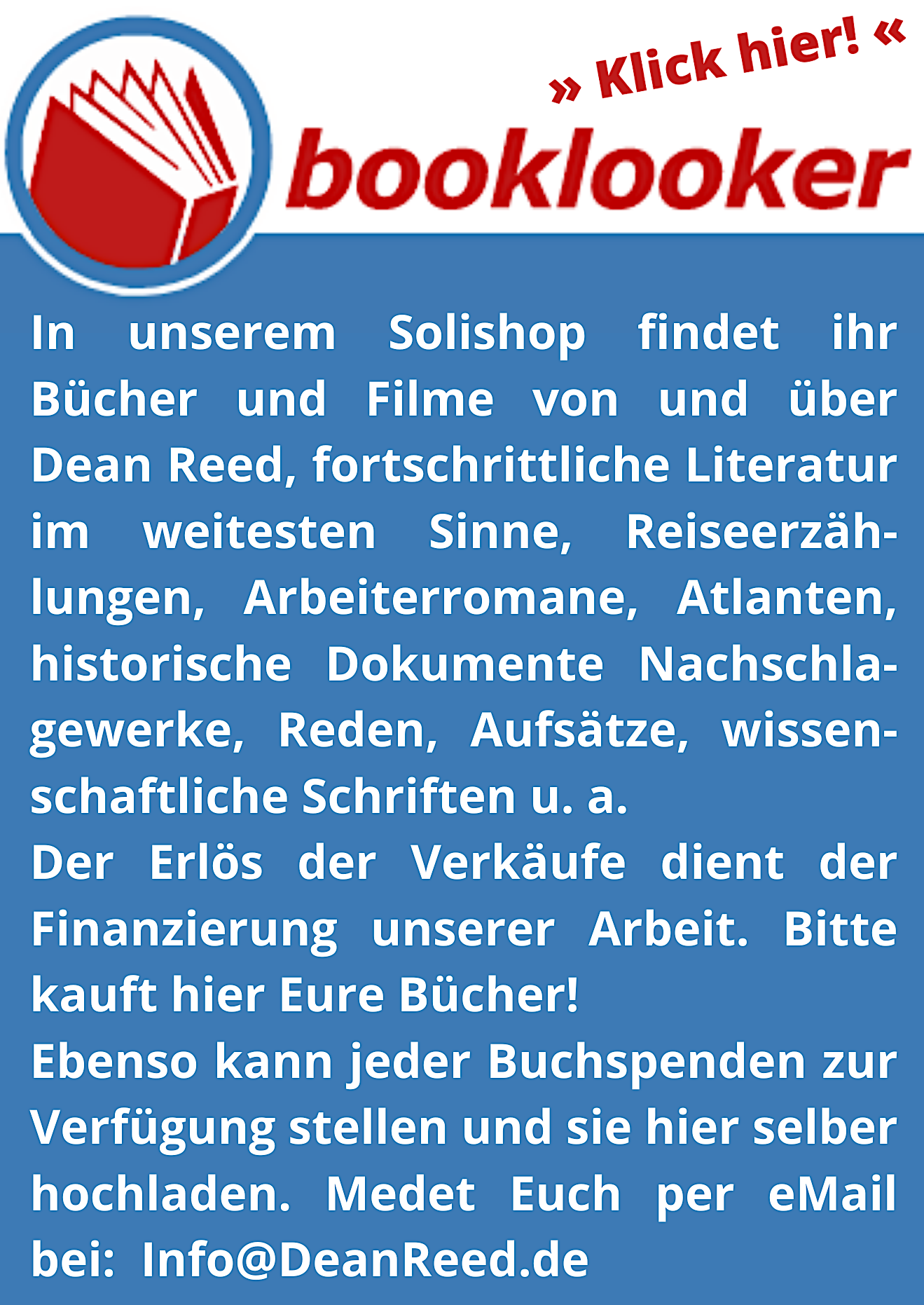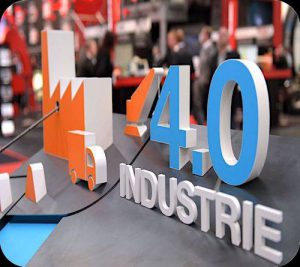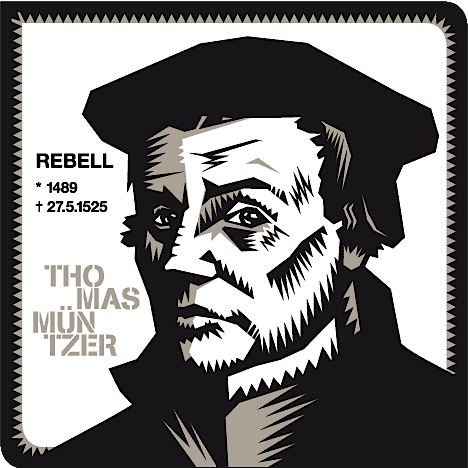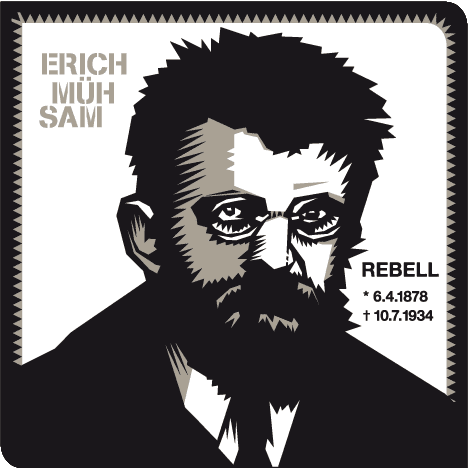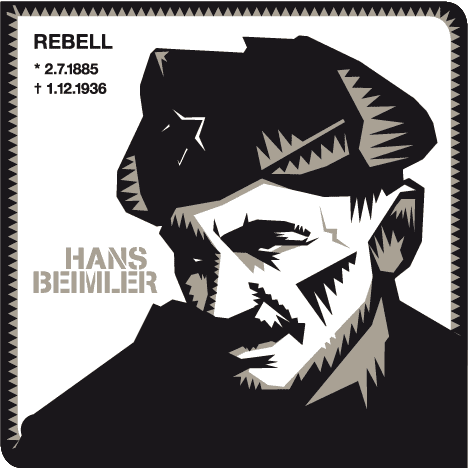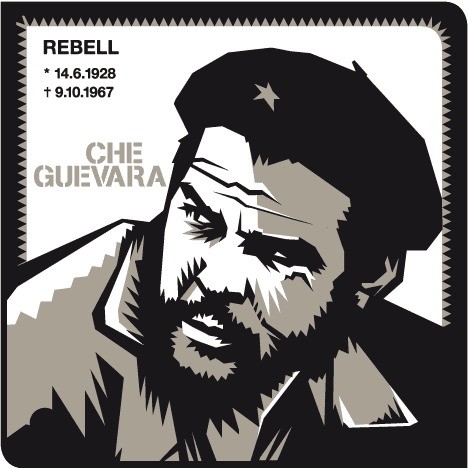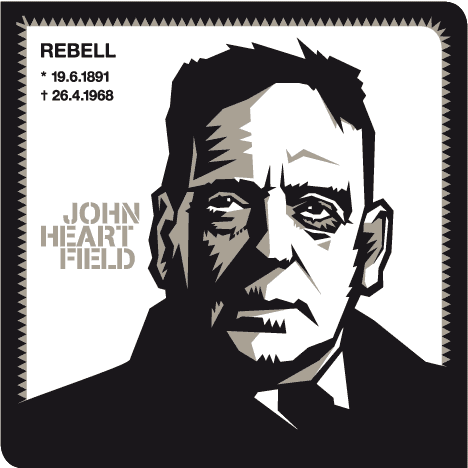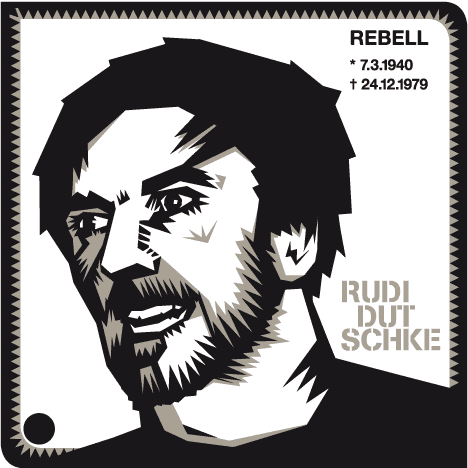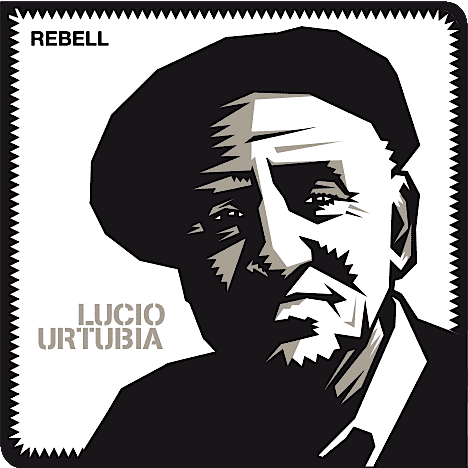Die Freiheitsliebe: Was sind die Hauptthemen der Wahlkampagne?
Tsafrir Cohen: Lieberman hat zwar seine Weigerung in eine rechte Koalition einzutreten zwar damit begründet, den politischen Einfluss der ultraorthodoxen Parteien nicht wachsen lassen zu wollen. Das ist allerdings fadenscheinig. Recht häufig ist er mit ihnen ausgezeichnet ausgekommen, zuletzt als es darum ging, einen missliebigen säkularen Bürgermeister in Jerusalem zu verhindern. Seine wahren Gründe liegen vielmehr in der persönlichen Rivalität zu seinem einstmaligen Mentor: Es ist ein lupenreiner Machtkampf, bei dem sich Lieberman an Netanjahu rächt und als sein Nachfolger zu präsentieren trachtet.
 Insgesamt spitzt sich bei diesen Wahlen die schon lange zu beobachtende Entwicklung zu, dass inhaltliche Auseinandersetzungen zugunsten der Frage nach der bevorzugten Führungsperson verblassen. Gegen die alten Haudegen Netanjahu und Lieberman setzt auch die Opposition auf erfahrene Krieger – im wahrsten Sinne des Worts. Blau-Weiß kann zwar keinen charismatischen Vorsitzenden vorweisen, dafür hat die Liste an ihrer Spitze gleich drei ehemalige Generalstabschefs der israelischen Armee. Auch die linke Meretz fürchtete, an der 3,25-Prozent-Hürde zu scheitern, und tat sich in mit dem ehemaligen Premier der Arbeitspartei und Generalstabschef Ehud Barak zusammen.
Insgesamt spitzt sich bei diesen Wahlen die schon lange zu beobachtende Entwicklung zu, dass inhaltliche Auseinandersetzungen zugunsten der Frage nach der bevorzugten Führungsperson verblassen. Gegen die alten Haudegen Netanjahu und Lieberman setzt auch die Opposition auf erfahrene Krieger – im wahrsten Sinne des Worts. Blau-Weiß kann zwar keinen charismatischen Vorsitzenden vorweisen, dafür hat die Liste an ihrer Spitze gleich drei ehemalige Generalstabschefs der israelischen Armee. Auch die linke Meretz fürchtete, an der 3,25-Prozent-Hürde zu scheitern, und tat sich in mit dem ehemaligen Premier der Arbeitspartei und Generalstabschef Ehud Barak zusammen.
Die Freiheitsliebe: Wie ist diese Personifizierung von Politik zu erklären?
Tsafrir Cohen: Dass die Parteien auf starke Männer setzen, ist dem Mangel an alternativen Entwürfen in den wichtigsten Feldern israelischer Politik geschuldet. Früher als in anderen Ländern befürwortete die stärkste Kraft der israelischen Linken, die sozialdemokratische Arbeitspartei, in den 1980er-Jahren die neoliberale Ideologie als alternativlose Wirtschaftspolitik und war ausschlaggebend für die Privatisierungs- und Niedrigsteuerpolitik ebenso wie für die Zerschlagung der Gewerkschaftsmacht. Und seitdem ihr damaliger Parteivorsitzender Ehud Barak im Jahr 2000 als Premierminister der israelischen Öffentlichkeit vollmundig und wider besseren Wissens verkündete, es gebe keinen Partner für Frieden auf palästinensischer Seite, hat die Partei auch keine Friedenspolitik mehr, die den Namen verdient. Sie erwähnt die Zweistaatenlösung nur noch im Kleingedruckten und stellt sie unter Bedingungen, die einen lebensfähigen Staat Palästina unmöglich machen.
In Ermangelung von inhaltlichen Alternativen reduziert sich der politische Diskurs auf ein reines Manövrieren um die Macht. Hierbei rücken zwei Fragen immer stärker in den Mittelpunkt: Welche Figur ist aufgrund ihrer persönlichen Eigenschaften am geeignetsten, das Land zu führen, und welche Gruppe erhält welchen Anteil vom Kuchen? Das Fehlen konkurrierender Zukunftsvisionen befördert das Desinteresse an Politik überhaupt und zugleich die Bejahung der gegenwärtigen Zustände: Es mag sein, sagen sich viele, dass es eine lang anhaltende Besatzung und Unterdrückung eines anderen Volks gibt – wir sehen aber keinen Ausweg und wollen uns dafür auch nicht mehr entschuldigen; es mag ebenfalls sein, dass die durchschnittliche Armutsrate in Israel mit 18 Prozent höher ausfällt als in allen anderen Industrieländern, die Mittelschicht schrumpft und der Reichtum sich bei einigen wenigen im Land konzentriert – wir können das aber sowieso nicht ändern, lasst uns deshalb lieber uns selber feiern. Was für eine Befreiung!
Entpolitisierung und die Bejahung der bestehenden Verhältnisse wirken systemstabilisierend. Gleichzeitig bleibt mitnichten alles beim Alten. Infolge abnehmender Solidarität in Zeiten einer neoliberalen Wirtschaftsordnung und der Schwächung des Staatsapparats und weiterer Institutionen, etwa der Gewerkschaften, sowie angesichts eines schwelenden nationalen Konflikts und der inhärenten Fragilität eines Einwanderungslandes gewinnt die Volkszugehörigkeit als Ort echter und vorgestellter Solidarität enorm an Bedeutung. Für die jüdische Mehrheitsgesellschaft Israels ist dieses Volk das jüdische Volk. Damit sind alle Ansätze aus den liberalen 1990er-Jahren obsolet geworden, die versuchten, das Staatsvolk durchlässiger zu denken, sprich nicht als gleichbedeutend mit dem jüdischen Volk allein, sondern – auch – als ein israelisches. Dann würden auch die arabisch-palästinensische Minderheit im Land, immerhin 20 Prozent der israelischen Staatsbürgerinnen und Staatsbürger, sowie nichtjüdische Migrantinnen und Migranten zum Staatsvolk gehören. Im aktuellen israelischen Diskurs ist es jedoch selbstverständlich, Vorteile der jüdischen Mehrheitsgesellschaft gegenüber Nichtjuden und auf deren Kosten zu bewahren und auszubauen. Das gilt für das 2018 beschlossene Nationalstaatsgesetz, das jüdische Gruppeninteressen über das Gleichheitsgebot der Demokratie stellt; und das gilt für die von der Bevölkerungsmehrheit unterstützten Versuche des Staats, alle nichtjüdischen, vor allem aus der Subsahara stammenden Geflüchteten – Kulturministerin Miri Regev nennt diese ein «Krebsgeschwür im Körper der jüdischen Nation» – des Landes zu verweisen und nichtjüdischen Arbeitsmigrantinnen das dauerhafte Niederlassungsrecht oder die Einbürgerung grundsätzlich zu verwehren.
Die Freiheitsliebe: Ist das ein wichtiger Grund für den enormen Erfolg von Netanjahu?
Tsafrir Cohen: Niemand verstand es besser als Netanjahu, diesen Rückfall in die Stammesidentität für sich auszunutzen und sich als Retter des jüdischen Volks zu gerieren. Sein Aufstieg zur unangefochtenen, ja schier unersetzlichen charismatischen Führungsfigur des Landes ist eng verbunden mit einer «Politik der Feindschaft», sprich der Instrumentalisierung von realen und imaginierten äußeren und inneren Gegnern Israels. Zu diesen zählten zunächst die Palästinenser und Palästinenserinnen und der Iran sowie der Unterzeichner der Oslo-Verträge, Jitzchak Rabin, das Friedenslager insgesamt und «die Linke» im Allgemeinen. In den vergangenen Jahren gerieten auch nichtjüdische Geflüchtete, Migrantinnen und Migranten ins Visier Netanjahus, zuletzt in wachsendem Maße Kritikerinnen und Kritiker seiner Politik im westlichen Ausland, denen er Israel-Feindschaft oder gar Antisemitismus vorwirft.
In der so imaginierten Dauerkrise erscheint Netanjahu als edler Ritter. Sind die Stammesinteressen die ausschlaggebende Bezugsgröße der politischen Diskussion, so erscheinen Institutionen wie die Parteien, die Medien oder die Gewaltenteilung als bloße Hindernisse auf dem Weg zur Durchsetzung des Volkswillens. Unter solchen Vorzeichen inszeniert sich Netanjahu – ungeachtet der Tatsache, dass er der am längsten amtierende Premier in der israelischen Geschichte ist – als Kämpfer des Volks gegen die Eliten und das Establishment. Den einst stolzen Likud hat er zu seinem Wahlverein degradiert und ihn von seiner alten Garde, die sich zwar stramm rechts positionierte, zugleich aber den Rechtsstaat achtete, gesäubert. Schließlich untergräbt Netanjahu im Namen des Volks die Arbeit und die Glaubwürdigkeit der Medien und der Institutionen, die für demokratische Kontrolle stehen und Rechtsstaatlichkeit, ordnungsgemäße Verwaltung und den Schutz der Menschenrechte garantieren. Das traf zuletzt sogar die Armee, eine bis dato «heilige» Institution, weil sie einen Soldaten vor ein Militärgericht stellte, der einen am Boden liegenden, schwer verletzten palästinensischen Attentäter erschossen hatte.

Netanjahu
Damit befindet sich Netanjahu in bester schlechter Gesellschaft. Auf riesigen Wahlplakaten posiert er mit Wladimir Putin, Narendra Modi und Donald Trump, und mit Rechtspopulisten geht er Allianzen ein, indem er etwa die antisemitische Kampagne des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán gegen den Investor und Philanthropen George Soros unterstützt. Zwar brüskiert er damit liberale Bündnispartner in der EU oder die Demokratische Partei und erhebliche Teile der traditionell linken bzw. liberalen jüdischen Gemeinden in den USA. Doch im Gegenzug erhält er die politische Unterstützung von jenen Kräften, die in ihm einen vorbildlichen illiberalen Demokraten und Verfechter des Ethnonationalismus sehen, von radikalen Evangelikalen in Baden-Württemberg, von der mitteleuropäischen Visegrád-Gruppe, die jedwede Kritik an der israelischen Besatzungspolitik durch die EU zu verhindern sucht, oder von US-Präsident Trump, dessen Entscheidung, die amerikanische Botschaft nach Jerusalem zu verlegen und die israelische Annexion der Golanhöhen anzuerkennen, Netanjahu innen- wie außenpolitisch erheblich stärkte.
Die Freiheitsliebe: Kann Netanjahus Likud die absolute Mehrheit erhalten?
Tsafrir Cohen: Wohl kaum. Ob er bei den kommenden Wahlen Erfolg haben wird, hängt davon ab, ob das rechte Lager auch ohne Liebermans Partei eine Mehrheit erhält. Derzeit liegt es Umfragen zufolge knapp unter der absoluten Mehrheit. Neben dem Likud, der bei geringen Einbußen mit etwa einem Viertel der Stimmen rechnen kann, gehören drei religiöse Parteien zu diesem Lager, darunter die beiden ultraorthodoxen Parteien Schas und Vereintes Thora-Judentum, die früher das Zünglein an der Waage zwischen Likud und der Arbeitspartei darstellten. Diese Funktion nutzten sie, um möglichst viel für ihre oft armen und familienreichen Klientel herauszuholen, hielten sich ansonsten aber aus der Politik heraus. Heute sind ihre Wählerinnen und Wähler fest im nationalistischen Lager verankert. Der dritte potenzielle Koalitionspartner ist die Liste Nach Rechts, eine Vereinigung mehrerer rechtsradikaler Parteien, die mit etwa zehn Prozent der Stimmen rechnen kann.
Bemerkenswert hierbei ist die fortschreitende Verzahnung der ultraorthodoxen und der nationalistischen Milieus zu einer sendungsbewussten, mitunter messianischen Gruppe, deren Vertreterinnen und Vertreter Schlüsselpositionen wie die Bildungs- und Justizressorts oder den Vorsitz des Finanzausschusses innehaben und so stetig an Einfluss gewinnen.
Die Freiheitsliebe: Wer fordert ihn jenseits von Lieberman heraus?
Tsafrir Cohen: Aufgeschreckt durch die ständige Hetze gegen den Rechtsstaat und die «Eliten» sowie durch die wachsende Macht der religiösen Parteien hat sich vor den letzten Wahlen Blau-Weiß (Kachol-Lawan, die Farben der Nationalfahne) konstituiert, eine aus drei neuen Parteien bestehende Liste. Mit vier Generälen, einer Generalin sowie mehreren gewichtigen Vertreterinnen und Vertretern aus Verwaltung und Medien repräsentiert die Liste das israelische Establishment. Ihr gemeinsamer Nenner ist die Gegnerschaft zu Netanjahu und zu den rechtspopulistischen Angriffen auf den Rechtsstaat und seine Institutionen. Die Korruption soll bekämpft, Rechtsstaat und Meinungsfreiheit sollen gestärkt, eine weitere Verzahnung von Staat und Religion soll verhindert werden. In anderen Bereichen unterscheidet sich Blau-Weiß indes nicht wesentlich vom Likud. Auch sie nutzen Netanjahus geflügeltes Wort, Israel müsse «ewig mit dem Schwert leben», und sprechen nicht von einer Zweistaatenlösung, sondern versprechen, sich nicht aus dem Jordantal und Ostjerusalem zurückzuziehen, was de facto eine Absage an einen lebensfähigen Palästinenserstaat darstellt. Und was den Gazastreifen betrifft, so brüstet sich die Liste damit, noch härter vorgehen zu wollen, als es Netanjahu tut. Auch die gegenwärtige Sozial- und Wirtschaftspolitik wird nicht grundsätzlich infrage gestellt. Den Umfragen nach würde Blau-Weiß erneut etwa ein Viertel der Stimmen auf sich vereinen.
Die Freiheitsliebe: Wie sieht es mit den linken Parteien aus?
Tsafrir Cohen: Während bei den anderen Parteien vieles gleich geblieben ist, hat es links von der Mitte große Veränderungen gegeben. Drei Listen stellen sich hier zur Wahl, jeweils anders ausgerichtet als bei den letzten Wahlen.
Zum einen handelt es sich um die einst so stolze Arbeitspartei, die Israels Politik von der Staatsgründung bis 1977 durchgehend dominierte und auch später gelegentlich den Premier stellte. Sie erhielt bei den letzten Wahlen gerade noch sechs Mandate (also knapp fünf Prozent), ein historisches Tief. Im anschließenden Richtungsstreit setzte sich Amir Peretz gegen zwei Kandidierende der jüngeren Generation durch, die bei den sozialen Protesten im Jahr 2011 eine führende Rolle gespielt hatten. Peretz, 1952 in Marokko geboren, war schon von 2005 bis 2007 Parteivorsitzender gewesen. Damals wie heute konnte er überzeugen als der Kandidat, der die Interessen ärmerer Bevölkerungsschichten, allen voran der Mizrachim, glaubhaft vertritt und diese einbinden kann. Für die Arbeitspartei ist dies überlebenswichtig, denn für Jüdinnen und Juden aus islamisch geprägten Ländern, die Mizrachim, die vor allem in den 1950er-Jahren nach Israel eingewandert sind und etwa die Hälfte der jüdischen Bevölkerung im Land ausmachen, ist sie bis heute kaum wählbar. Die Arbeitspartei gilt als die Partei, die zwar Gleichheit predigte, die Mizrachim zugunsten der aus Europa stammenden Aschkenasim aber benachteiligte, mitunter rassistisch behandelte und am sozioökonomischen Aufstieg hinderte.[4] Mit der Wahl des Gewerkschafters und ehemaligen Bürgermeisters der peripheren, armen und in der Regel stramm rechts wählenden Kleinstadt Sderot in direkter Nachbarschaft zum Gazastreifen macht die Arbeitspartei, so der Publizist Meron Rapoport, einen revolutionären, aber überfälligen Schritt.[5] Zu lange habe die Linke insgesamt die jüdischen Peripherien vernachlässigt, wo ein Viertel der Stimmen zu vergeben ist, die linken Parteien aber lediglich drei Prozent der Wählerstimmen erhalten. Zur Wahl stellt sich die Arbeitspartei zusammen mit der von Mizrachi- und feministischen Aktivistinnen gegründeten Gescher (hebr.: Brücke), die sich vom rechten Lager aufgrund starker Divergenzen im sozioökonomischen Bereich abgespalten hat. Das Wahlprogramm der Liste Blau-Weiß ist geradezu revolutionär für die Arbeitspartei und zielt auf einen radikalen Richtungswechsel in der Sozial- und Wirtschaftspolitik. Durch eine höhere staatliche Verschuldung und eine höhere Besteuerung der Wohlhabenden sollen Investitionen in die Infrastruktur getätigt, der Mindestlohns auf 40 NIS (ca. zehn Euro) erhöht, die Invaliden- und Rentenbezüge angehoben und die Bildungseinrichtungen und Gesundheitsdienste wieder völlig aus Steuereinnahmen finanziert werden. In Bezug auf das Verhältnis zur palästinensischen Minderheit in Israel oder auf Friedensfragen bleibt die Liste vage, sieht jedoch einen Investitionsstopp für Siedlungen in der Westbank jenseits der großen Siedlungsblöcke vor. Ob die Wählerinnen und Wähler sich von einer so kurz vor den Wahlen erklärten Rückkehr zu den Grundsätzen linker sozialdemokratischer Politik überzeugen lassen, scheint fraglich, zumal die Arbeitspartei seit geraumer Zeit kaum Präsenz zeigt oder an lokalen Kämpfen teilnimmt.
Dann gibt es Meretz, die sich für einen umgekehrten Kurs entschieden hatte. Meretz nennt sich nach wie vor stolz eine linke Partei, tritt für einen historischen Kompromiss mit den Palästinenser und Palästinenserinnen ein und steht für sozialdemokratische bis sozialistische Wirtschaftspositionen sowie eine progressive Geschlechter-, Verkehrs- und Umweltpolitik. Bei den kommenden Wahlen hat sich Meretz mit dem ehemaligen Premier Ehud Barak zum Demokratischen Lager zusammengeschlossen. Baraks Anliegen ist die Lösung des israelisch-palästinensischen Konflikts. Wie Meretz plädiert er für eine Zweistaatenlösung. Andererseits ist Barak bei der arabisch-palästinensischen Minderheit in Israel umstritten, wenn nicht gar verhasst, weil er im Oktober 2000 als Premierminister die blutige Unterdrückung von Protesten in den arabischen Städten im Norden Israels zu verantworten hatte. Meretz stärkt durch das Bündnis mit Barak ihren Ruf als Partei des schwindenden europastämmigen Bildungsbürgertums, gefährdet aber gleichzeitig ihren Erfolg bei der palästinensischen Minderheit, der ihr bei den letzten Wahlen ein Viertel ihrer Gesamtstimmen bescherte. Andererseits könnte sie diejenigen Stimmen aus der Arbeitspartei holen, die den neuen Kurs der Partei nicht mittragen wollen, weil diese ihren europäischen und urbanen Subtext abstreift und sich den Peripherien, den Marginalisierten und den Mizrachim öffnet.
Die Freiheitsliebe: Und dann gibt es auch die Gemeinsame Liste.

Wahlplakat der Gemeinsamen Liste; (unten rechts auf arbabisch und hebräisch: „Meine/Unsere Antwort auf Rassismus“, auf der Wand steht: „Araber Raus!“, )
Genau. Die 2015 gegründete Gemeinsame Liste galt als große Hoffnung der palästinensischen Staatsbürgerinnen und Staatsbürger Israels, die ihr bei den Wahlen 2015 zu 85 Prozent die Stimme gaben und sie mit 13 Abgeordneten zur drittgrößten Fraktion in der Knesset machten. Im Vorfeld der Wahlen im April 2019 zerbrach sie an persönlichen Querelen. Aus einer gemeinsamen Liste wurden zwei völlig willkürlich zusammengesetzte Listen, die zusammen lediglich zehn Mandate erhielten. Sich dem Willen der Wählerinnen und Wähler beugend, entstand die Gemeinsame Liste jetzt erneut als Zusammenschluss von vier unterschiedlichen Parteien, die die Interessen der palästinensischen Minderheit in Israel vertreten. Die Liste versammelt sehr unterschiedliche politische Positionen, von sozialistischen über liberale bis zu islamisch-konservativen. In der gesamten arabischen Welt – aber auch in Europa, gar weltweit – wurde die Liste aufmerksam, mitunter begeistert wahrgenommen, schließlich stellte sie 2015 einen Gegenpol zu den mitunter kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen ebendiesen Gruppen in anderen Ländern der Region dar. Unter ihren Kandidierenden gibt es Muslime, Christen, Drusen, Beduinen sowie einen jüdischen Sozialisten. Vor allem die sozialistische Demokratische Front für Frieden und Gleichheit, Chadasch/al-Dschabha, sorgte innerhalb des Bündnisses dafür, dass die Gemeinsame Liste ein Programm besaß, das nicht nur die Interessen der palästinensischen Minderheit in Israel berücksichtigte, sondern eine progressive Vision – ein Ende der Besatzung, eine Demokratie, die mehr ist als die Willensbekundung der Mehrheit und mehr soziale Gerechtigkeit – für Israel insgesamt beinhaltete. Ob die Gemeinsame Liste ihren Erfolg von 2015 am 17. September wiederholen kann, ist fraglich, denn die persönlichen Streitereien des Führungspersonals Anfang des Jahres haben zu einer Politikverdrossenheit vor allem unter jungen Wählerinnen und Wählern geführt. Die palästinensischen Staatsbürgerinnen und Staatsbürger Israels noch einmal mobilisieren zu können, das hängt auch vom Verhalten der anderen Oppositionsparteien ab. Wenn sich jenseits von Meretz keine Partei findet, die sie – anders als das rechte Lager, das sie für schlicht illegitim hält und aus dem politischen Spiel grundsätzlich ausschließt – als Verbündete wahrnimmt, so wird es zunehmend schwer zu vermitteln sein, warum die palästinensischen Staatsbürgerinnen Israels überhaupt an Wahlen teilnehmen sollten. Vor diesem Hintergrund hat sich der Vorsitzende der Gemeinsamen Liste, Ayman Odeh, bereit erklärt, sich einer Mitte-links-Koalition anzuschließen, wenn Blau-Weiß einigen grundlegenden Forderungen zustimmt, die Israels palästinensischen Bürgerinnen und den Friedensprozess betreffen, sodass die arabischen Bürger keine Bürger zweiter Klasse mehr sind. Dieses historische Koalitionsangebot ist umgehend auf Ablehnung gestoßen: Blau-Weiß wies jede Zusammenarbeit mit der Gemeinsamen Liste zurück, der Likud warnte sogar vor der Gefahr einer von Terroristen unterstützten Regierung
Die Freiheitsliebe: Was sind die Aussichten für die Zeit nach den Wahlen?
Die Schlüsselfrage dieser Wahlen lautet, ob Benjamin Netanjahu noch auf dem Zenit seiner Macht ist oder ob sie das Ende seiner rechtspopulistischen Ära bringen werden. Am wahrscheinlichsten ist eine erneute Pattsituation, in der beide Lager das andere zu destabilisieren trachten. Netanjahu wird alles in seiner Macht Stehende für die Bildung einer Koalition tun, um aus der vorteilhaften Position eines amtierenden Premiers sich den nahenden Gerichtsverhandlungen zu stellen oder diese zu verhindern. Er wird die instabilen Listen Blau-Weiß und Arbeitspartei-Gescher bzw. einzelne Abgeordnete dieser Listen durch inhaltliche Zugeständnisse oder mittels Posten ködern wollen. Blau-Weiß und Lieberman werden im Gegenzug versuchen, den Likud gegen den bewunderten und gefürchteten, aber kaum geliebten Netanjahu aufzuwiegeln. Schließlich wird auch die Staatsanwaltschaft ein Wörtchen mitreden, und von ihren Entscheidungen, wann und ob Netanjahu vor Gericht gestellt wird, könnte einiges abhängen.
Wie auch immer die Wahl ausgeht, so ist friedenspolitisch kaum mit positiven Veränderungen zu rechnen, denn gut 80 Prozent der Stimmen werden Parteien zukommen, die sich explizit oder implizit und mit unterschiedlicher Rhetorik gegen die Gründung eines lebensfähigen Palästinenserstaats und damit einer Zweistaatenlösung stellen. Je rechter die Mehrheit ausfällt, umso wahrscheinlicher wird eine Politik, die durch weitere Kolonisierungsprozesse, bei denen die Palästinenserinnen und Palästinenser zugunsten israelischer Infrastruktur in dicht bevölkerte Enklaven verdrängt werden, eine Friedenslösung auch künftigen Generationen verbaut. Bei sozioökonomischen Fragen ist ebenfalls keine progressive Wende zu erwarten, und es wird darauf ankommen, ob die zart aufkeimenden Forderungen nach mehr sozialer Gerechtigkeit größeren Zuspruch außerhalb des Parlaments erhalten.
Ausschlaggebend könnte die Wahl jedoch in Sachen Rechtsstaatlichkeit sein. Gewinnt das rechte Lager, so ist mit einem weiteren Abbau der Demokratie zu rechnen sowie mit einer noch stärkeren Verzahnung von religiös-messianischen und ethnonationalistischen Diskursen zu einem toxischen Gemisch, das mit Demokratie kaum vereinbar ist. Verliert das rechte Lager oder benötigt es einen Koalitionspartner aus dem bisherigen Oppositionslager, so könnten diese Prozesse gestoppt oder gar rückgängig gemacht werden. Insgesamt gilt aber auch dann die alte Feststellung, dass ein Land kaum demokratisch verfasst sein kann, wenn es gleichzeitig auf Dauer einem anderen Volk systematisch die Selbstbestimmung verweigert und damit Millionen von Menschen Bürger- und Menschenrechte vorenthält.
Israels linke Parteien finden sich bei diesen Wahlen in einer ungewöhnlichen Konstellation wieder. Keine der drei Listen links von der Mitte ist eine klassisch linke. Vielmehr spricht jede von ihnen eine Teilöffentlichkeit an und ist folglich eine Interessenvertretung. Während die Gemeinsame Liste vor allem den Anspruch erhebt, die palästinensischen Staatsbürgerinnen und Staatsbürger Israels zu repräsentieren, ist das Demokratische Lager klar eine Friedensliste europäischer Konvenienz, deren Sozialprofil – entsprechend ihrer gut situierten, urbanen Wählerschaft – zwischen links und liberal oszilliert. Die Liste Arbeitspartei-Gescher hingegen spricht marginalisierte Gruppen an, vor allem die Mizrachim, hat aber mitnichten ein linkes friedenspolitisches Profil. Damit ist das linke Lager nach Milieus zersplittert. Ob diese Listen – jede für sich oder gemeinsam – dem rechtsnationalistischen Hegemonialdiskurs einen progressiven entgegenstellen können, bleibt eine offene Frage.
Die Freiheitsliebe: Danke dir für das Gespräch.



 Ziyad Clot dürfte manchen LeserInnen bekannt sein, denn er ist der Whistle-Blower der PLO. Sein Name ist auf ewig verbunden mit den Palestine Papers, jenen Papieren, die die Handlungsunwilligkeit der israelischen Regierung zeigten und weltweit für Aufsehen sorgten. Ziyad Clot ist französischer Jurist mit Schwerpunkt Wirtschaftsrecht und wechselte von einer Pariser Großkanzlei an den Verhandlungstisch des arabisch-israelischen Konfliktes.
Ziyad Clot dürfte manchen LeserInnen bekannt sein, denn er ist der Whistle-Blower der PLO. Sein Name ist auf ewig verbunden mit den Palestine Papers, jenen Papieren, die die Handlungsunwilligkeit der israelischen Regierung zeigten und weltweit für Aufsehen sorgten. Ziyad Clot ist französischer Jurist mit Schwerpunkt Wirtschaftsrecht und wechselte von einer Pariser Großkanzlei an den Verhandlungstisch des arabisch-israelischen Konfliktes.
 Insgesamt spitzt sich bei diesen Wahlen die schon lange zu beobachtende Entwicklung zu, dass inhaltliche Auseinandersetzungen zugunsten der Frage nach der bevorzugten Führungsperson verblassen. Gegen die alten Haudegen Netanjahu und Lieberman setzt auch die Opposition auf erfahrene Krieger – im wahrsten Sinne des Worts. Blau-Weiß kann zwar keinen charismatischen Vorsitzenden vorweisen, dafür hat die Liste an ihrer Spitze gleich drei ehemalige Generalstabschefs der israelischen Armee. Auch die linke Meretz fürchtete, an der 3,25-Prozent-Hürde zu scheitern, und tat sich in mit dem ehemaligen Premier der Arbeitspartei und Generalstabschef Ehud Barak zusammen.
Insgesamt spitzt sich bei diesen Wahlen die schon lange zu beobachtende Entwicklung zu, dass inhaltliche Auseinandersetzungen zugunsten der Frage nach der bevorzugten Führungsperson verblassen. Gegen die alten Haudegen Netanjahu und Lieberman setzt auch die Opposition auf erfahrene Krieger – im wahrsten Sinne des Worts. Blau-Weiß kann zwar keinen charismatischen Vorsitzenden vorweisen, dafür hat die Liste an ihrer Spitze gleich drei ehemalige Generalstabschefs der israelischen Armee. Auch die linke Meretz fürchtete, an der 3,25-Prozent-Hürde zu scheitern, und tat sich in mit dem ehemaligen Premier der Arbeitspartei und Generalstabschef Ehud Barak zusammen.

 Gebietsannexionen
Gebietsannexionen