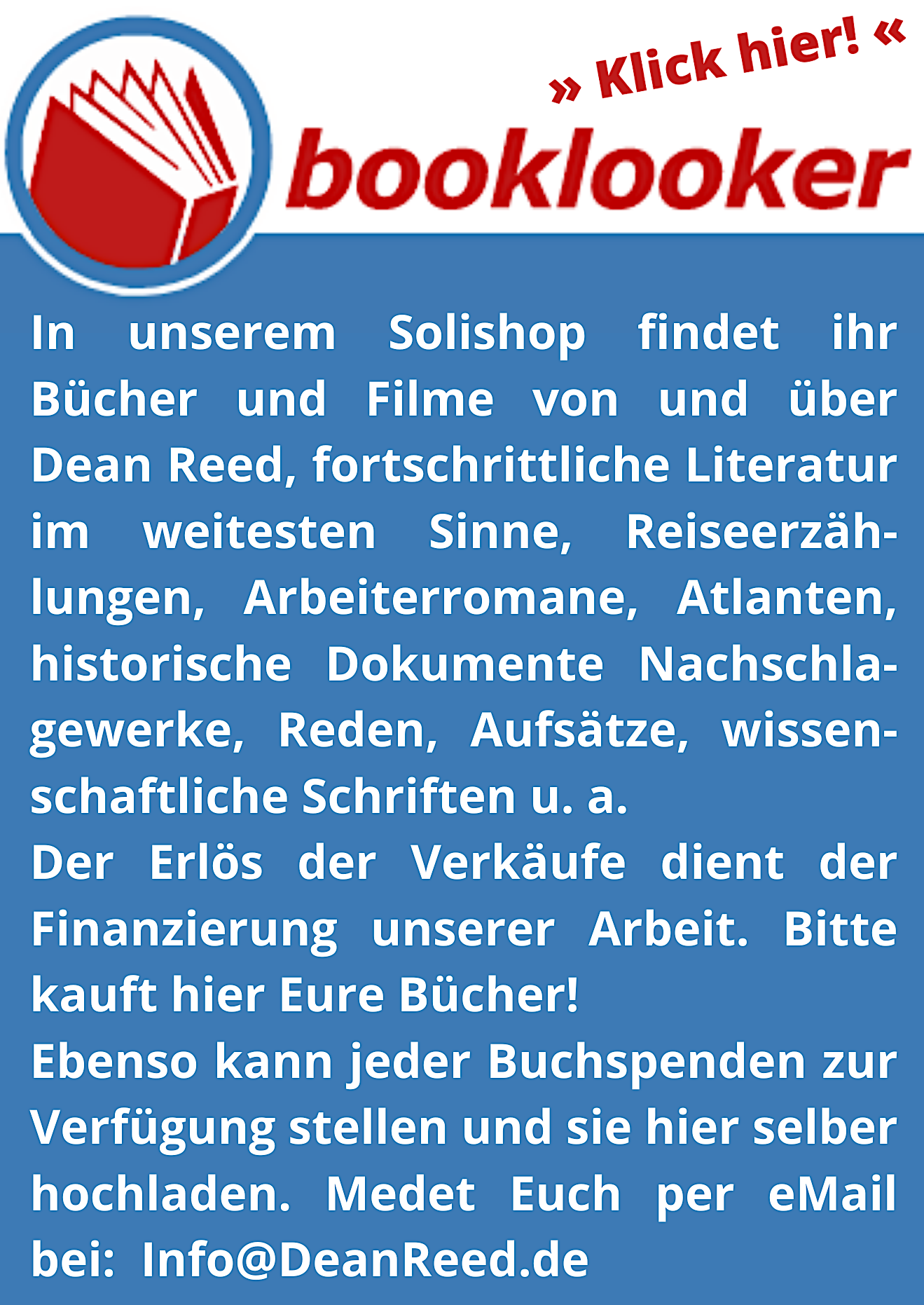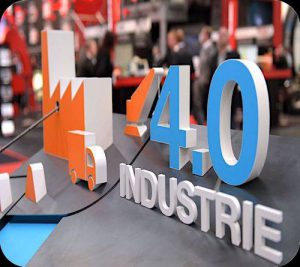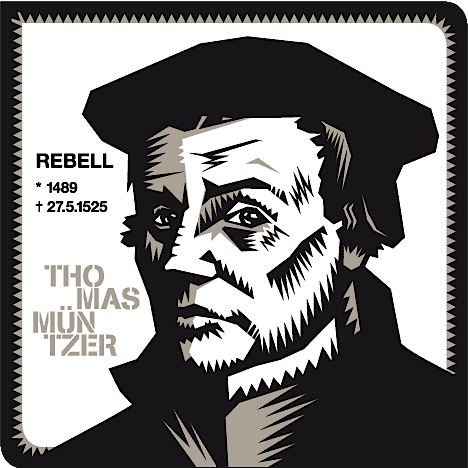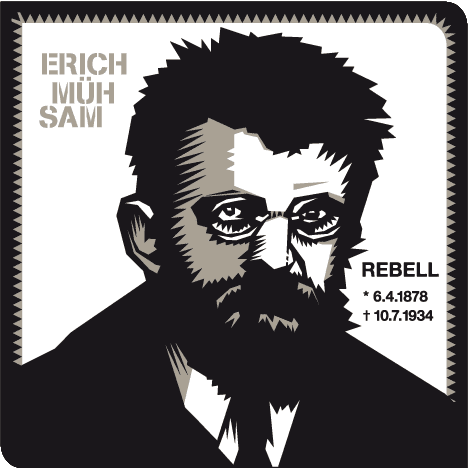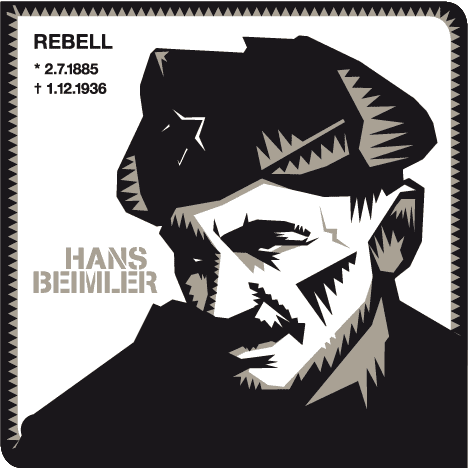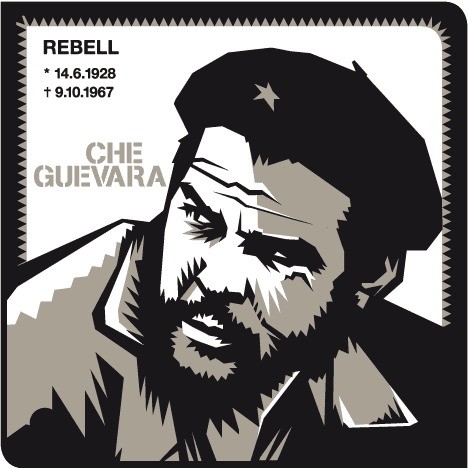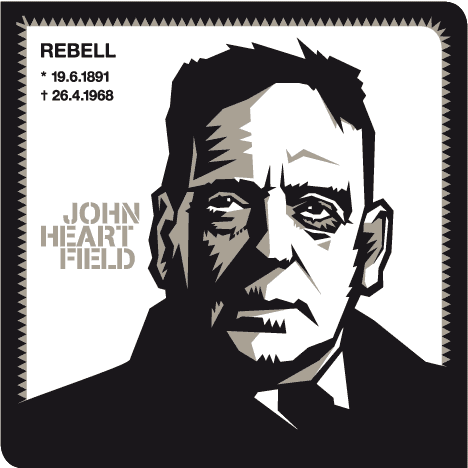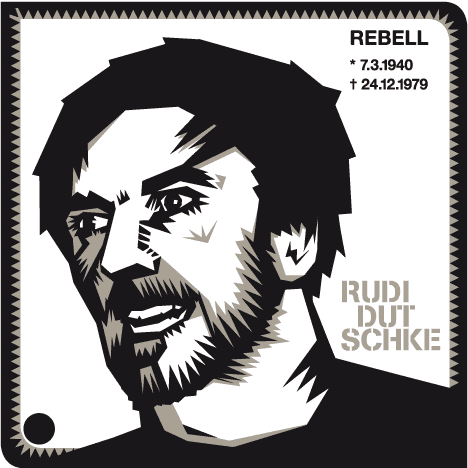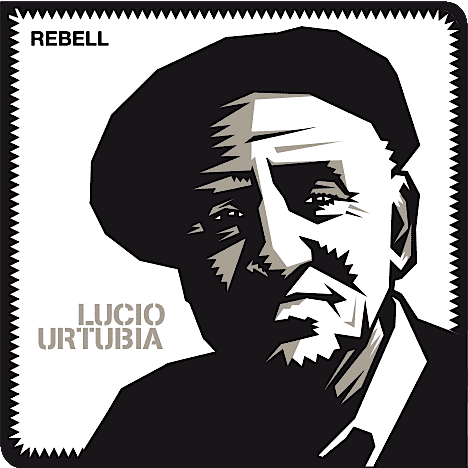Foto: KieferPix/Shutterstock.com
Der Soziologe Peter Fuchs bezeichnet die Psychotherapie als die „Verwaltung der vagen Dinge“. Patentrezepte gibt es hier nicht. Klare, naturwissenschaftlich unanfechtbare und fassbare Lösungen kann es hier nicht geben, da einerseits jeder Patient anders leidet – und wenn wir noch so viele neue Kategorien und Namen für psychische Erkrankungen schaffen – und andererseits die Ursache niemals völlig geklärt werden kann. Allzu oft liegen Ursachen psychischer Krankheiten in einer Melange aus biologischen Faktoren, tiefenpsychologischen Einflüssen und Umständen der Sozialisation, deren einzelne Anteile auch bei noch so guter Diagnostik niemals restlos auseinander sortiert werden können. Das gilt auch deswegen, weil sich etwa prägende Phasen wie die frühkindliche der Erinnerung des Menschen weitestgehend entziehen und daher nur schwer aufgearbeitet werden können.
Diese „vage“ Natur der Psychotherapie bringt es mit sich, dass sie anfällig wird für verschiedenste Formen der Interpretation, der Politisierung, der Manipulation. Wo sich empirische Erkenntnisse nicht zweifelsfrei ergeben, da arbeitet der Sozialwissenschaftler mit Theorien und Hypothesen. Eine Tatsache, die unvermeidlich ist, aber auch nicht grundsätzlich problematisch, auch wenn sie vielen eher „technisch“ denkenden Menschen, für die am Ende immer ein klares Ergebnis, ein „A oder B“ stehen muss, oft suspekt ist.
Problematisch wird es erst, wenn diese Interpretationsanfälligkeit geschickt genutzt wird, um mit ihrer Hilfe „hinten rum“ eine politische Ideologie zu verwirklichen, die dem Menschen – dem Patienten – am Ende des Tages alles andere als zum Vorteil gereichen wird. Bei der modernen Psychotherapie ist genau dieses Phänomen vorzufinden – was umso schlimmer anmutet deswegen, weil es damit Menschen trifft, die ihr leidendes Innerstes offen legen, weil sie sich anders nicht zu helfen wissen.
.
Die Frage der Verantwortung
Analog zur Frage, was zuerst da war, die Henne oder das Ei, wird auch die Psychotherapie stets von der Frage nach der Verantwortlichkeit – noch drastischer: „Schuld“ – für die Erkrankung des Betroffenen begleitet. Ein Mitarbeiter eines Betriebes leidet am Burnout-Syndrom: Hat sein Arbeitgeber zu viel von ihm verlangt – oder er von sich selbst? War das Arbeitsklima schuld – oder er einfach zu „dünnhäutig“, zu schwach, zu wenig bereit, auch seine Ellenbogen einzusetzen?
Das Szenario muss sich nicht auf den Arbeitsplatz beschränken. Ein weiteres Beispiel: Eine junge Frau leidet an Depressionen. Im Gespräch kommt heraus, dass sie unter schwierigen familiären Verhältnissen aufgewachsen ist. Sind es nun die Eltern, die die Verantwortung für ihr Leid tragen – oder hat die junge Frau einfach nie „zu sich selbst gefunden“? Hat sie sich „gehen lassen“, sich nicht genug von ihrer Vergangenheit emanzipiert? Hätte sie mehr „kämpfen“ müssen?
Es wird schnell deutlich: Wir haben es bei psychischen Erkrankungen mit Phänomenen zu tun, deren Ursachen-Herleitung mehr als komplex ist und die Tür öffnet für verschiedenste Antworten. Und das gilt nicht nur im laienhaften Umfeld, das für die junge Frau aus dem Beispiel entweder Verständnis hat oder über sie die Nase rümpft, sondern auch manche „Profis“ gehen mit sehr unterschiedlichen Prämissen an die Leiden der exemplarischen jungen Frau heran.
.
Das Resilienz-Konzept
Ein Schlüsselbegriff zum Verständnis der Unterschiedlichkeit dieser Prämissen ist der der „Resilienz“. Die Psychologie versteht darunter die psychische Widerstandskraft des Einzelnen (aber auch, in anderen Auslegungen, einer Gruppe oder einer Organisation). Diese Kraft kann sich aus verschiedensten Einflüssen (den „Ressourcen“, wie die Psychologie sie nennt) ergeben: Dazu zählen Intelligenz, emotionale Kontrolle, Ausgeglichenheit, Selbstsicherheit, positive innere Einstellung usw. usf. Auf Gruppen- oder Team-Ebene sind das Klima der Interaktion und der gegenseitige Umgang entscheidende Faktoren; auf Organisationsebene auch Führungsentscheidungen und formale Strukturen der Organisation. An verschiedenen Stellen wird ein „betriebliches Resilienz-Management“ vorgeschlagen, das dazu beitragen soll, die Resilienz der Mitarbeiter zu stärken, um ihre Arbeitsleistung zu erhöhen.
Nun ist es sicherlich niemals ein Fehler, die Resilienz von Gruppen beziehungsweise Teams in einem Betrieb und damit auch die organisationale Resilienz des Betriebs als Ganzes zu stärken, indem etwa für ein gutes Arbeitsklima gesorgt wird. Doch der Resilienz-Begriff hat eine primäre Konnotation – und diese bezieht sich auf den Einzelnen, auf das Individuum und seinen seelischen Zustand. Die Grundthese der Vertreter des Resilienz-Konzeptes lautet, dass das Individuum, der einzelne Arbeitnehmer letztlich – und auf jeden Fall zu beträchtlichen Teilen – selbst imstande wäre, sich vor Erkrankungen wie dem Burnout-Syndrom zu schützen, wenn er nur „widerstandsfähig“ genug ist.
Es deutet sich langsam an, worin das neoliberale Element eben dieser Denkweise liegt: Indem die Verantwortung für seine psychische Gesundheit am Arbeitsplatz auf ihn selbst verschoben wird, es also von seiner eigenen Resilienz, seiner inneren Einstellung und Haltung abhängig ist, wie er mit den Anforderungen der Arbeit, mit den Arbeitszeiten, den Erwartungen von Kollegen und Vorgesetzten etc. umgeht, liegt sie eben nicht mehr – oder wenigstens zu deutlich geringeren Teilen – beim Arbeitgeber. Der Arbeitnehmer bricht irgendwann infolge allzu vieler Überstunden zusammen? Erleidet einen Burnout? Gerät in Konflikt mit Kollegen oder dem Chef? Erledigt seine Aufgaben nicht mehr zu deren Zufriedenheit? Nun: Da war er dann wohl nicht resilient genug!
Die Prämisse, die hier mitschwingt, ist eine, die wir bereits aus der Europapolitik von Angela Merkel kennen: Die der vermeintlichen Alternativlosigkeit des großen Ganzen. Die politischen oder eben wirtschaftlichen Strukturen sind demnach quasi gottgegeben – und die kleineren Einheiten, in der EU die Nationalstaaten, im Wirtschaftssystem die Arbeitnehmer, haben sich diesen unveränderbaren, alternativlosen Gegebenheiten anzupassen, wenn sie nicht untergehen wollen. Der Einzelne ist seines Glückes Schmied – und kann dabei alles gewinnen oder eben alles verlieren, je nachdem, ob er zur Genüge an seiner Resilienz gearbeitet hat.
Nun wird es verschiedene Gründe haben, warum Psychologen und Psychotherapeuten diese Prämisse aufgreifen. Weder liegt diesem Phänomen eine große Verschwörung zugrunde, noch sind die derart vorgehenden Psychologen und Psychotherapeuten allesamt neoliberale Hardliner, die sich händereibend überlegen, wie sie dem globalen Turbokapitalismus noch besser als bisher zu Diensten sein könnten. In vielerlei Fällen spielt hier vielmehr ein Phänomen mit hinein, das man – überspitzt ausgedrückt – als Fachidiotentum bezeichnen könnte: So wie sich beispielsweise allzu viele Politologen zu wenig für die psychischen Einflüsse auf politische Prozesse interessieren, mangelt es auch Psychologen zuweilen an Interesse für politische Hintergründe und politische Motivationen hinter wissenschaftlichen oder therapeutischen Konzeptionen. Aber auch wenn man es oftmals eher mit Ignoranz anstatt mit Böswilligkeit zu tun hat: Das Sich-Instrumentalisieren-Lassen für neoliberale Intentionen entschuldigt dies nicht.
.
Skepsis gegenüber therapeutischen Interventionen
Das Resilienz-Konzept stellt bei weitem nicht die einzige Erscheinungsform neoliberalisierter Psychotherapie dar. Eine andere, um exemplarisch noch eine weitere zu nennen, tritt im Rahmen der Systemischen Beratung und Therapie in Erscheinung. Diese ist zwar als Ganzes – so viel soll hier klargestellt werden – keinesfalls als ein „neoliberales therapeutisches Verfahren“ zu bezeichnen; sie greift aber theoretische Prämissen auf, die das Aufnehmen solcher Grundsätze zumindest nicht unwahrscheinlich machen.
Konkreter: Eine vielfach diskutierte Frage in Bezug auf die Psychotherapie und die Systemische Therapie im Speziellen ist die nach der Berechtigung und Sinnhaftigkeit von Interventionen seitens des Beraters oder Therapeuten. Anders gesagt: Wie sehr darf der Berater oder Therapeut sich „einmischen“? Wie sehr darf er „steuern“? Ist hierbei „Steuerung“ überhaupt legitim oder sinnvoll? In welcher Rolle sieht sich der Berater oder Therapeut selbst in der Interaktion mit dem Klienten / Patienten? Kann er es als „gesetzt“ betrachten, dass er manche Dinge „besser weiß“ als der Klient / Patient, oder hilft er diesem lediglich bei der Selbstfindung? Liegen die Lösungen im Klienten / Patienten selbst – oder auch im Berater oder Therapeuten?
Auch hier wird deutlich: Die Reflexion der eigenen professionellen Rolle und, daraus hervorgehend, der des Klienten / Patienten, die Frage nach der Selbstdefinition und der eigenen Verortung sind entscheidende Fragen für das therapeutische Prozedere, welche alles andere als verbindlich geklärt sind. In vielerlei Fällen bleibt Raum für Interpretationen und – je nach therapeutischem Verfahren und je nach Person – fallen die Antworten unterschiedlich aus. Und oftmals werden auch hier – mal bewusst, mal unbewusst – neoliberale Prämissen aufgegriffen.
In der der Systemischen Beratung und Therapie zugrunde liegenden, interdisziplinär aufgegriffenen Systemtheorie wird von der Annahme ausgegangen, dass wir es im Alltag mit hochkomplexen biologischen, psychischen und sozialen Systemen zu tun haben. Biologische Systeme bezeichnen dabei die Körper von Lebewesen, psychische Systeme das menschliche Bewusstsein und soziale Systeme Interaktionen zwischen Personen, Gruppen, Organisationen oder die Gesellschaft als Ganzes.
Von nicht wenigen Systemtheoretikern wird dabei eine tief reichende Steuerungsskepsis vertreten, die sich aus eben jener These der hochkomplexen Systeme herleitet: Jene Systeme sind demnach kaum steuerbar, da es dafür seitens des „Steuernden“ ein grundlegendes Verständnis und eine umfassende Kontrolle aller Dynamiken bräuchte, die das System und seine Komplexität ausmachen. Diese sei jedoch nicht vorhanden und auch kaum zu erreichen, da Systeme füreinander immer bis zu einem gewissen Grad intransparent sind: Das politische System kennt nicht alle künftigen Entwicklungen des Wirtschaftssystems, und ein psychisches System kennt kein anderes psychisches System „von innen“, weil wir uns nicht gegenseitig in die Köpfe schauen können, es also immer vieles gibt, was wir von der anderen Person niemals erfahren werden. Dies sind nur einige kurz angerissene Beispiele für das, was nach der Systemtheorie die unüberwindbare Komplexität von Systemen ausmacht.
Innerhalb der anwendungsbezogenen Systemischen Beratung und Therapie wird daraus nun – nicht immer und von allen, aber häufig – die Konklusion abgeleitet, dass therapeutische Interventionen, ebenso wie etwa direkte politische Steuerungsversuche des Wirtschaftssystems, mindestens skeptisch zu sehen, im Extremfall sogar grundsätzlich zum Scheitern verurteilt sind, weil ja auch der Berater oder Therapeut das psychische System des Patienten / Klienten nicht „durchschauen“ kann, sondern nur mit dem kalkulieren kann, was dieser ihm erzählt. Eine Intervention ist demnach mindestens riskant bis illegitim, da sie die Systemkomplexität des anderen ausblenden würde.
Stattdessen, so vertreten es die Verfechter dieser Denkrichtung, sollen die Antworten auf sein Problem von dem Klienten / Patienten selbst kommen: Nur er selbst kennt sich eigentlich gut genug, nur er selbst weiß letztlich, was er braucht oder nicht. Der Berater oder Therapeut hat in einem solchen Verhältnis nicht mehr die Aufgabe, Antworten zu liefern, sondern nur noch, die richtigen Fragen zu stellen. Typische Berater- oder Therapeutenfragen in diesem Zusammenhang lauten: „Was brauchen Sie?“, „Was würden Sie jemandem raten, der sich mit genau diesem Problem an Sie wendet?“ etc.
Die Parallelen zum Resilienz-Konzept sollten an diesem Punkt deutlich geworden sein. Sicherlich gilt hier die Einschränkung, dass nicht jede therapeutische, die Denkprozesse des Patienten / Klienten in positive und konstruktive Bahnen lenkende Frage sofort Ausdruck eines zynischen neoliberalen Therapieverständnisses ist. Und dennoch zeigt sich die Prämisse der „Eigenverantwortlichkeit“, des „Jeder ist seines Glückes Schmied“ auch hier: Die Antworten auf sein Problem liegen in dieser Denkrichtung im Betroffenen selbst; der Berater oder Therapeut zieht sich, gleich dem steuerungsskeptischen Staat im Neoliberalismus, auf eine lediglich „stimulierende“, aber nicht mehr intervenierende „Nachtwächter“-Rolle zurück, als eine Art leiser Stichwortgeber, aber immer mit dem Unterton „Nur du kannst dir selbst helfen – ich nicht!“.
.
Wachsamkeit ist geboten
Nun wird es, so viel sei abschließend klargestellt, durchaus Fälle geben, in denen diese Herangehensweise ebenso wie das Resilienz-Konzept fruchten und konstruktive Ergebnisse erzielen. Manchmal liegen die Antworten eben wirklich in der Person selbst, und manchmal schützt eben psychische Widerstandsfähigkeit wirklich ausreichend vor Belastungen am Arbeitsplatz. Nur haben wir es hier mit einem weiter reichenden Paradigma zu tun: Das Resilienz-Konzept und die Skepsis gegenüber Interventionen sind in Teilen durchaus dogmatisch vorgegeben, haben also nicht selten den Charakter einer allgemeingültigen Grundregel angenommen.
Spätestens hier wird es problematisch: Denn psychische Widerstandskraft und ihre Stärkung durch „betriebliches Resilienz-Management“ rechtfertigt keine Überbelastungen am Arbeitsplatz, welchen durch derartige Maßnahmen ihre Legitimation als „zumutbar“ zugestanden werden sollen. Und zugleich dürfte sich auch noch so mancher Patient / Klient finden lassen, bei dem die Antworten auf sein Problem eben nicht irgendwo „in ihm selbst“ liegen, sondern es einer klaren Intervention bedarf, um es zu lösen – z. B. in dessen soziale Systeme.
In jedem Fall ist es geboten, ein wachsames Auge zu richten auf politische Prozesse, die sich abseits der „üblichen“ Bühnen der Politik abspielen, aber dennoch gravierende Wirkung entfalten können. Die wissenschaftlichen Deutungshoheiten von heute bestimmen die gesellschaftliche Realität von morgen.











 Über den Autor: Florian Sander ist Dozent für Soziologie, Sozialpsychologie und Politikwissenschaft sowie Verhaltenstrainer an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung NRW, der in Nordrhein-Westfalen unter anderem die Polizeiausbildung obliegt. Zugleich ist er Doktorand im Fach Soziologie an der Bielefeld Graduate School in History and Sociology der Uni Bielefeld. Daneben betätigt er sich seit vielen Jahren als Autor für den Blog „Le Bohémien“.
Über den Autor: Florian Sander ist Dozent für Soziologie, Sozialpsychologie und Politikwissenschaft sowie Verhaltenstrainer an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung NRW, der in Nordrhein-Westfalen unter anderem die Polizeiausbildung obliegt. Zugleich ist er Doktorand im Fach Soziologie an der Bielefeld Graduate School in History and Sociology der Uni Bielefeld. Daneben betätigt er sich seit vielen Jahren als Autor für den Blog „Le Bohémien“.

 untypischen Aushang. Axel Meyer (55), seit 2017 der neuer Pächter der Tankstelle, die zum Willer-Konzern gehört, bat um Verständnis für eine vorbildhafte Überlegung (siehe rechts).
untypischen Aushang. Axel Meyer (55), seit 2017 der neuer Pächter der Tankstelle, die zum Willer-Konzern gehört, bat um Verständnis für eine vorbildhafte Überlegung (siehe rechts).














 Damit wird auf die Gemeinde der LGBTI, der Lesben, Gays, Bisexuellen, Transgender/Transsexuellen and Intersexed People, aufmerksam gemacht und für ihre Rechte und gesellschaftliche Anerkennung demonstriert. Mehr Freiheiten, wie das Heiraten unter Gays und Lesben oder die Adoption von Kindern sind in vielen Ländern immer noch verboten oder stark eingeschränkt.
Damit wird auf die Gemeinde der LGBTI, der Lesben, Gays, Bisexuellen, Transgender/Transsexuellen and Intersexed People, aufmerksam gemacht und für ihre Rechte und gesellschaftliche Anerkennung demonstriert. Mehr Freiheiten, wie das Heiraten unter Gays und Lesben oder die Adoption von Kindern sind in vielen Ländern immer noch verboten oder stark eingeschränkt.