Benjamin Luig
Lebensmittelproduktion – Ausbeutung mit Systemrelevanz

Benjamin Luig
Ein Ende der Ausbeutung auf Spargelfeldern und in Fleischfabriken setzt die Überwindung des institutionalisierten Rassismus ebenso voraus wie die Einschränkung der Marktmacht der Supermarktkonzerne. Das Verbot von Werkverträgen und Leiharbeit in Schlachthöfen ist dazu nur der erste Schritt.

Steak aus Deutschland – Sieht ecker aus, doch daran klebt Ausbeutung, Erniedrigung, Demütigund und schlechte hygienische Verarbeitung… Bild: ementar, Pixabay CC0
Die Berichte von haarsträubenden Arbeitsrechtsverletzungen an migrantischen Arbeiterinnen und Arbeitern aus Osteuropa reißen nicht ab. Vor dem Erdbeer- und Spargelhof Ritter bei Bornheim protestierten Anfang dieser Woche die rumänischen Saisonarbeiter*innen. Statt des vereinbarten Lohns erhielten sie über Wochen nur ein geringes Taschengeld und verschimmeltes Essen zugeteilt und es mangelte an grundlegender hygienischer Versorgung und warmem Wasser. Zeitgleich werden täglich neue Corona-Fälle in Schlachtfabriken von Müller Fleisch, Westfleisch und Tönnies festgestellt. Die Arbeiterinnen und Arbeiter werden in Massenunterkünften untergebracht und arbeiten am Schlachtband mit geringen Abständen im Akkord. Die körperlich anstrengende Arbeit macht es schwer, rund um die Uhr die Gesichtsmasken zu tragen. So wird der Arbeitsplatz zu einem Ort des besonderen Übertragungsrisikos.

Corona-Virus in Deutschen Schlachthöfen. Bild: YouTube
Das Absurde: Gerade zu Coronazeiten wurde von Seiten der Regierung wochenlang immer wieder die Systemrelevanz der Beschäftigten im Ernährungssystem betont, zugleich jedoch das bestehende Arbeitsrecht aufgeweicht. Obwohl es in den Tarifverträgen längst eine weitreichende Flexibilität gibt, entschied die Bundesregierung, in der Ernährungswirtschaft die gesetzliche Höchstarbeitszeitregelung außer Kraft zu setzen und die Maximalarbeitszeit auf 12 Stunden pro Tag zu erhöhen. Erst in dieser Woche ging die Regierung eines der Kernprobleme an: Sie verbietet ab 2021 die Ausbeutung über Werkverträge in der Fleischindustrie. Für Werkverträge besteht keine Meldepflicht, weshalb das bisherige Ausmaß schwer zu erfassen ist. Eine Untersuchung der Hans-Böckler-Stiftung kam bereits 2013 zu dem Ergebnis, dass 57 Prozent der Nicht-Stammbelegschaft in der Ernährungsindustrie über Werkverträge bei Subunternehmen angestellt wurden. Werkvertragsarbeiterinnen erhielten pro Stunde 6 Euro weniger als die Stammbelegschaft. Diese Form der Scheinselbständigkeit ist in jeder Hinsicht inakzeptabel. Während sie sich in anderen Branchen aber auf zugekaufte Servicebereiche beschränkte (also beispielsweise die Gebäudereinigung in Fabriken), kamen die Fleischkonzerne jahrelang damit durch, die Kerntätigkeit in ihren Fabriken – das Zerteilen der Tiere – als externe Dienstleistung einzustufen. Ein absurdes Konstrukt.
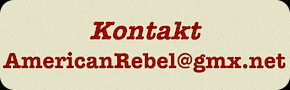

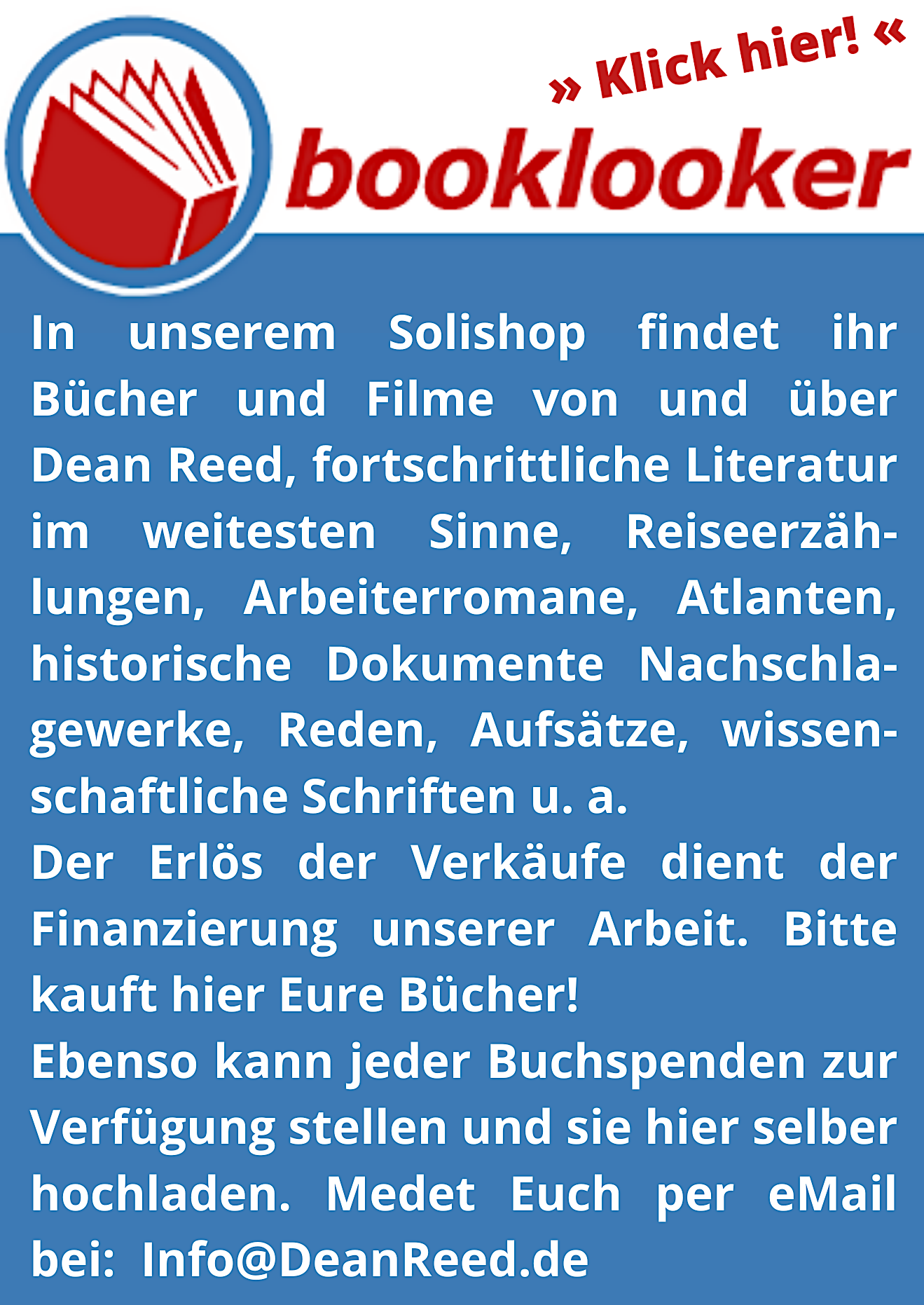
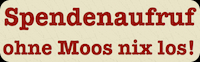
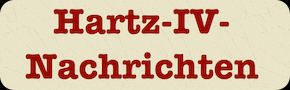



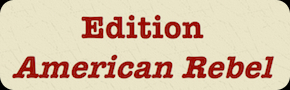
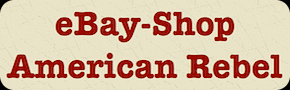
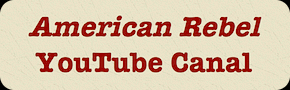



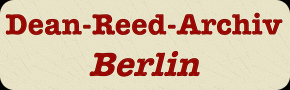
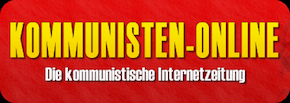

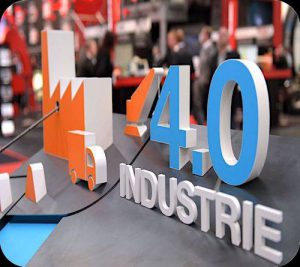

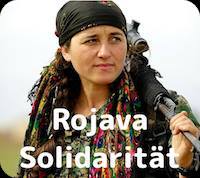
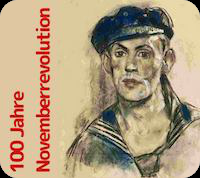
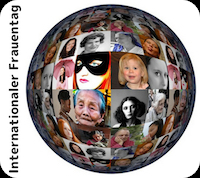


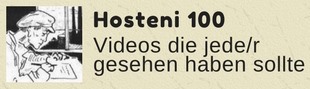




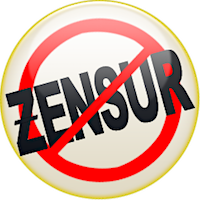
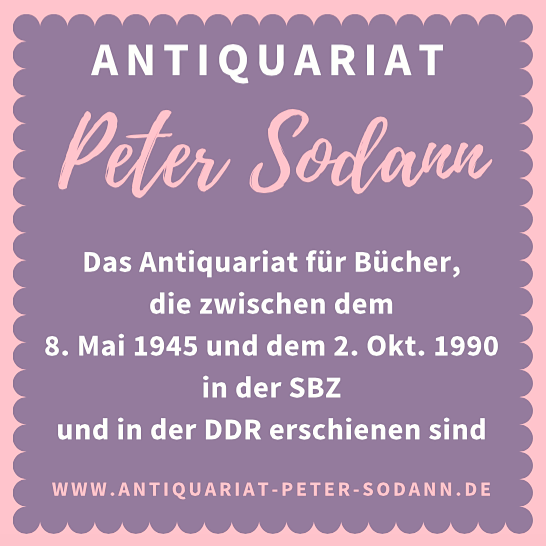
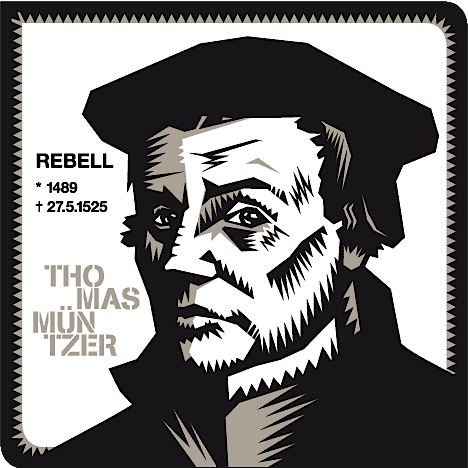
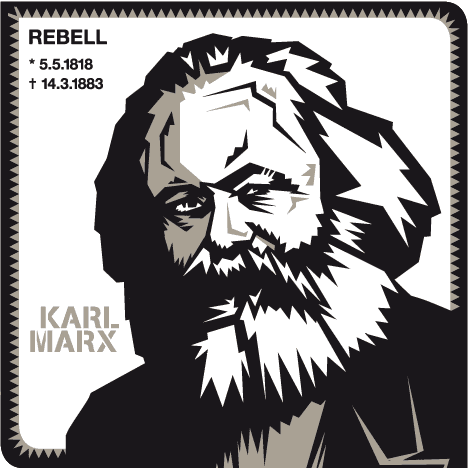
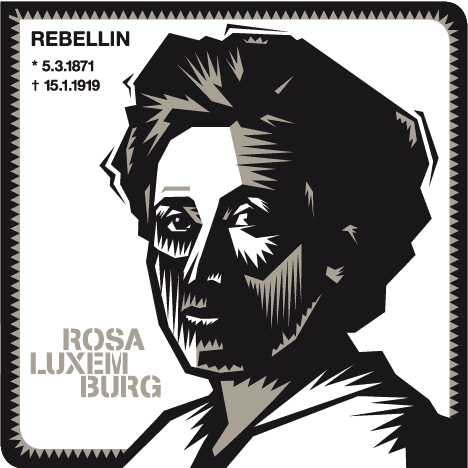
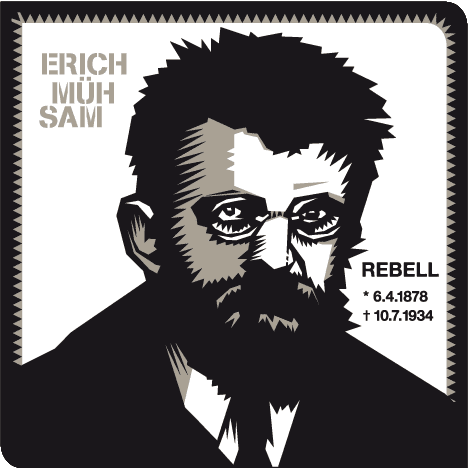
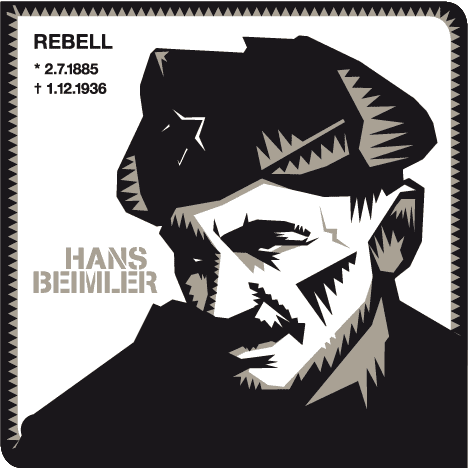
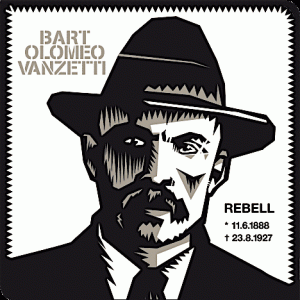
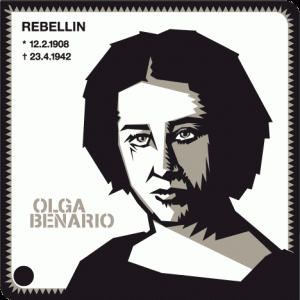
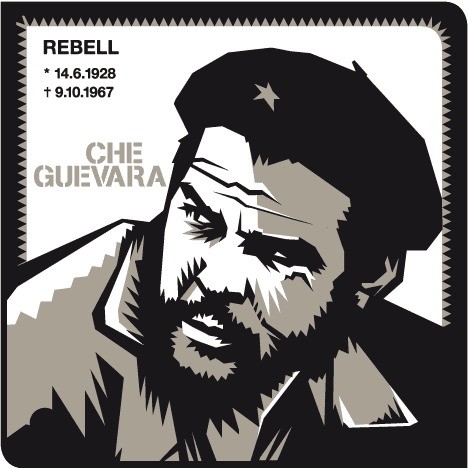
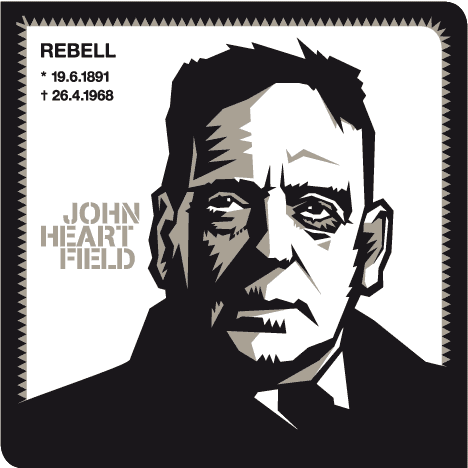
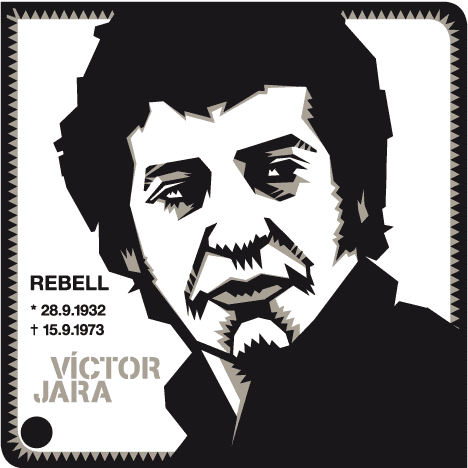
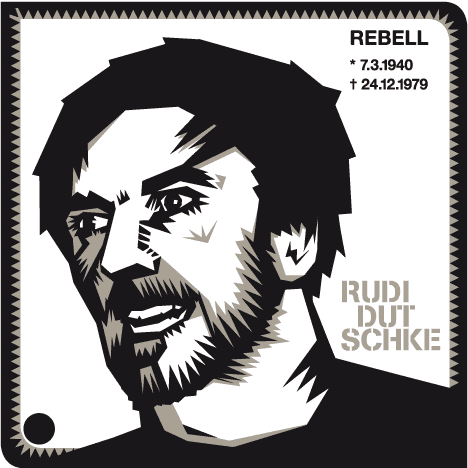
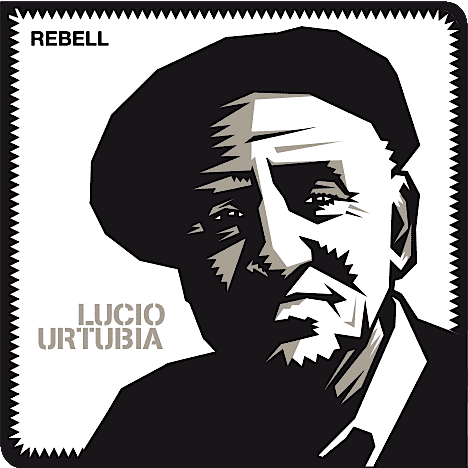
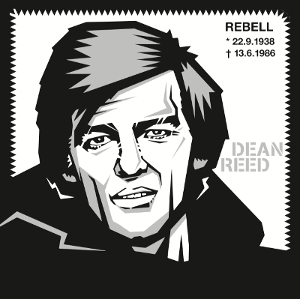
Diskussion ¬