F.-B. Habel
Berlinale 2018: In faszinierender Maske
Was macht ein gutes Biopic aus? Drei Beispiele aus zwei Sektionen

F.-B. Habel
Ein Film über eine bekannte Persönlichkeit sollte mindestens eine wesentliche Episode aus deren Leben erzählen. Für Wiedererkennung sollte in erster Linie der Duktus sorgen, in zweiter die markante Erscheinung. Drittens sollte es über die bloße Illustration des Lebensabschnitts hinaus um Probleme gehen, die uns heute unter den Nägeln brennen. Dann kann es ein guter Film werden.
Der britische Schauspielstar Rupert Everett hat für sein Regiedebüt die letzten zwei Jahre von Oscar Wilde gewählt. Der im November 1900 im Pariser Exil gestorbene bisexuelle Dandy war auf dem Höhepunkt seines Ruhms vom Vater seines Geliebten beleidigt worden. Wilde klagte und wurde in einem spektakulären Prozess wegen unzüchtigen Verhaltens zu einer zweijährigen Kerkerstrafe mit Zwangsarbeit verurteilt. Ausgestoßen von der Gesellschaft, die ihn eben noch gefeiert hatte, floh er nach Frankreich. Dies klingt in Rückblenden an, während sich der Film »The Happy Prince« (Sektion Special) ganz auf Wildes Leben mit den wenigen verbliebenen Freunden konzentriert, die ihn finanziell weiter unterstützen, obwohl der Exzentriker auch sie vor den Kopf stößt. Er muss Schulden machen, leidet an einer nicht eindeutig diagnostizierten Krankheit.

Rupert Everett als Oscar Wilde
Foto: © Wilhelm Moser
Everett hat viel Können in das Szenarium gesteckt und den Film konventionell, aber stimmig inszeniert. In faszinierender Maske spielt er den siechen Autor, der unter dem Einfluss populärer Gifte immer wieder zu guter Form findet. Seine Freunde Bosie und Robbie Ross werden von Colin Morgan und Edwin Thomas erstaunlich treffend charakterisiert. Die Aktualität ist durch noch verbreitete Vorurteile gegenüber Homosexuellen gegeben, die sich selbst in einer liberalen Stadt wie Berlin nicht immer sicher fühlen können.
Bevor Astrid Ericsson unter dem Namen Lindgren bekannt wurde, hatte sie schwere Jahre zu durchleben, weil ihr Sexualverhalten nicht der gesellschaftlichen Norm entsprach. Sie verführte ihren noch nicht geschiedenen Chef, wurde schwanger, wollte das Kind und musste es in Kopenhagen bei einer Pflegemutter lassen. »Becoming Astrid« der dänischen Regisseurin Pernille Fischer Christensen hält sich eng an die Biographie, und Alba August interpretiert die Titelrolle so stilsicher zwischen Phantasie und Ernsthaftigkeit, Verzweiflung und Lebenslust, dass ihr ein Bär als beste Darstellerin sicher gewesen wäre, hätte man den Film für den Wettbewerb ausgewählt. Er läuft ebenfalls in der Sektion Special.
Für den Silbernen Bären steht Marie Bäumer zur Debatte, der schon in jungen Jahren große Ähnlichkeit mit Romy Schneider attestiert wurde. Doch die Physiognomie ist es nicht allein. Charmant und eindringlich zeigt Bäumer die ganze Gefühlspalette der Schneider, vor allem den tiefen Schmerz, der zu ihrem Ende führte. Regisseurin Emily Atef erzählt (mit einem kleinen Epilog) nur drei Tage im Herbst 1981, an denen die Schauspielerin in einem Sanatorium im französischen Quiberon dem Stern-Reporter Michael Jürgs das letzte und wohl intimste Interview ihres Lebens gab. Ihr Freund, der Fotograf Robert Lebeck, ist dabei. Der heutige Zuschauer kennt Lebeck und Jürgs aus TV-Interviews und kann ermessen, wie präzise sich Charly Hübner und Robert Gwisdek in ihre Rollen hineingearbeitet haben. Aber was bietet der Wettbewerbsbeitrag über Faszination an Romy Schneider hinaus? Hätte uns dieser Film über einen Star aus Ungarn oder Portugal auch etwas zu sagen? Diesen Schritt schafft »3 Tage in Quiberon« nicht.
Trailer: »3 Tage in Quiberon«
Aus Junge Welt vom 24. Februar 2018, mit freundlicher Genehmigung des Autors.
.
Berlinale 2018 (1. Teil)
Weitere Artikel von F.-B. Habel
F.-B Habels offizielle Website
.


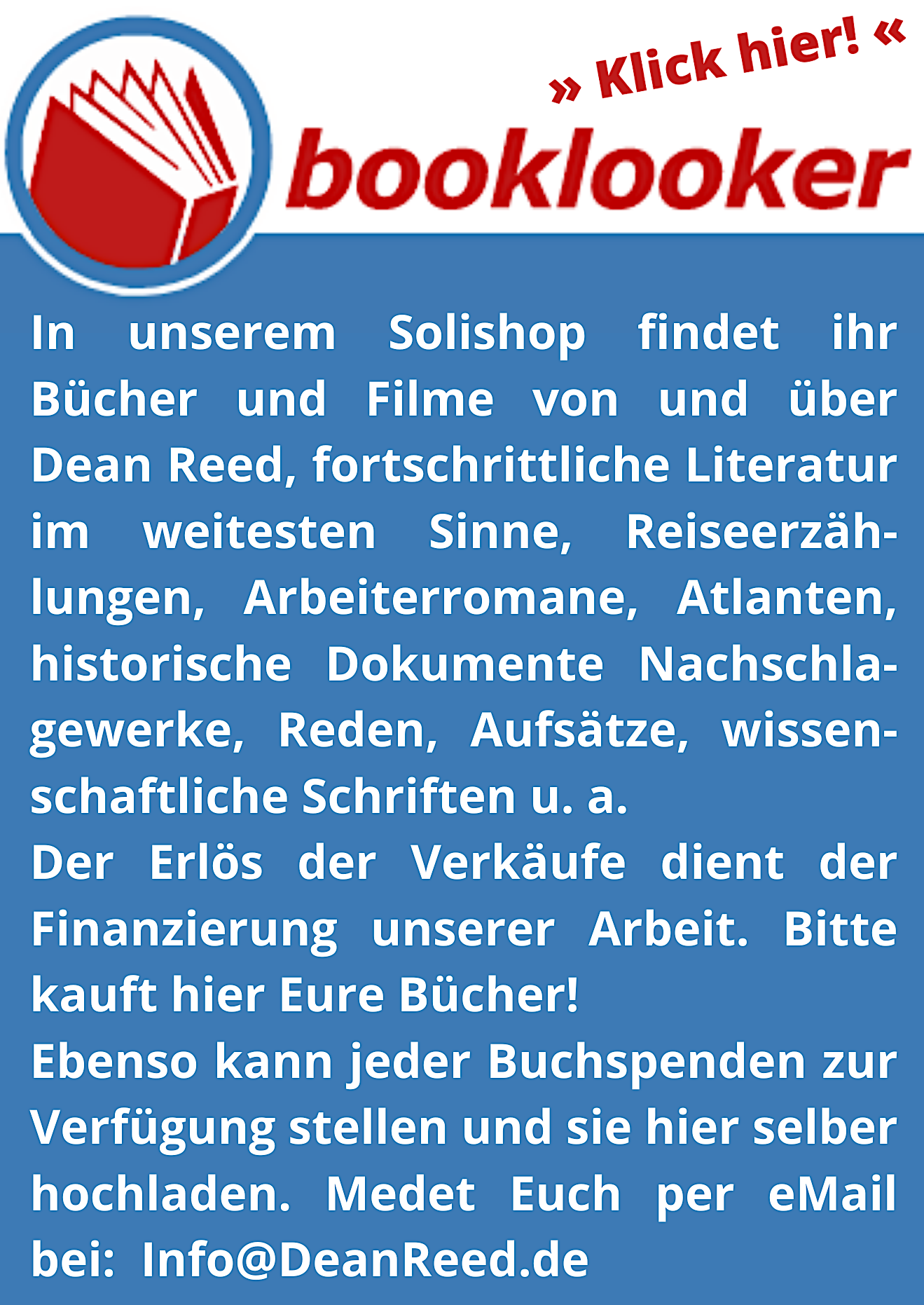














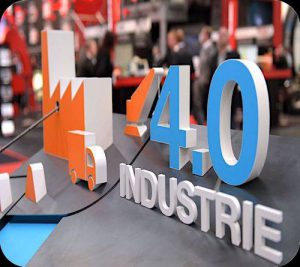













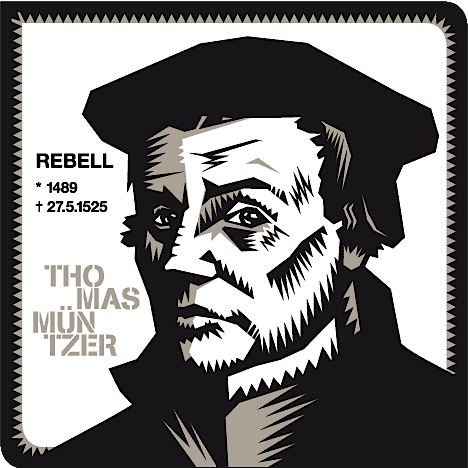


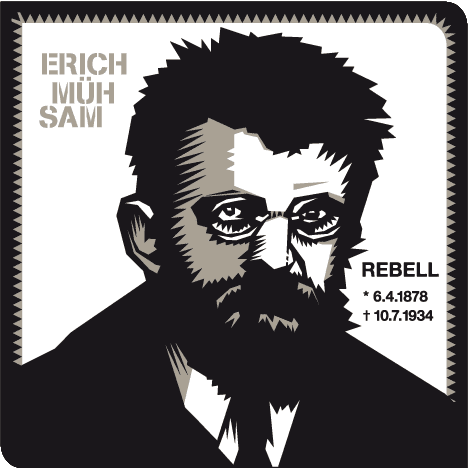
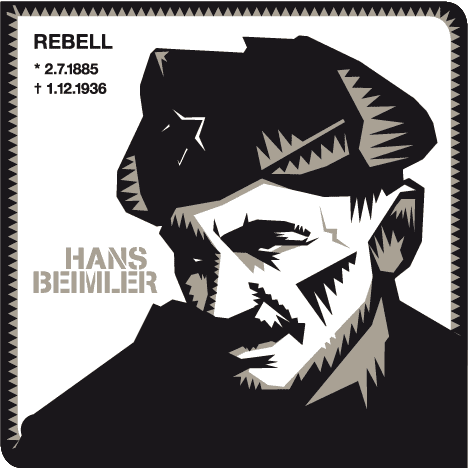


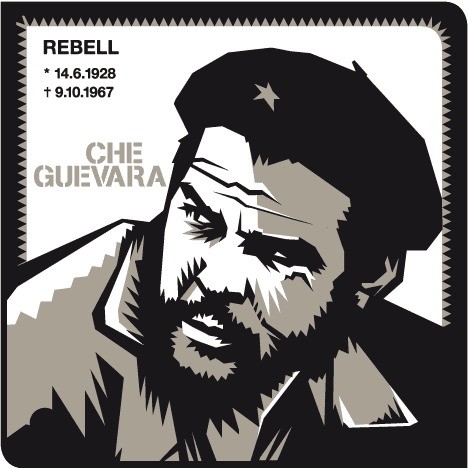
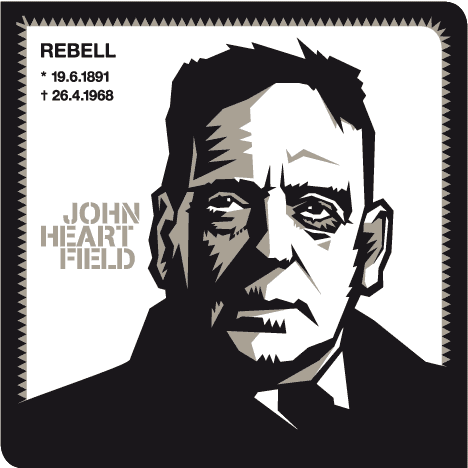

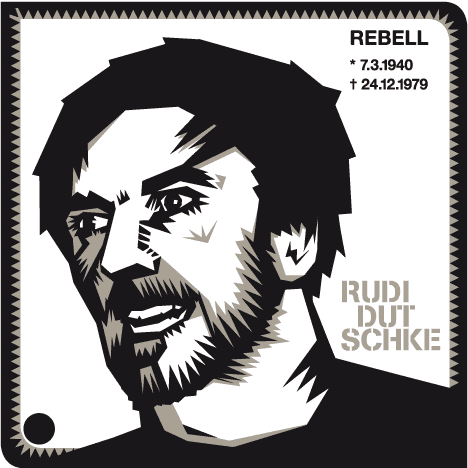
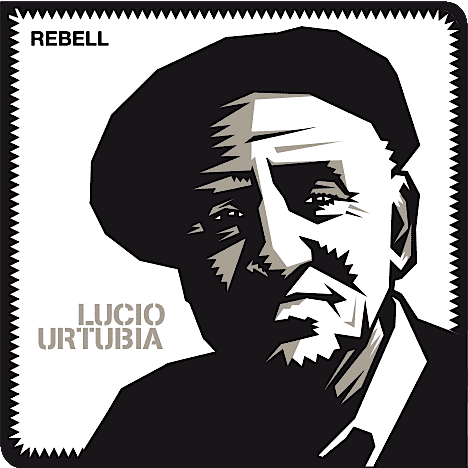

Diskussion ¬